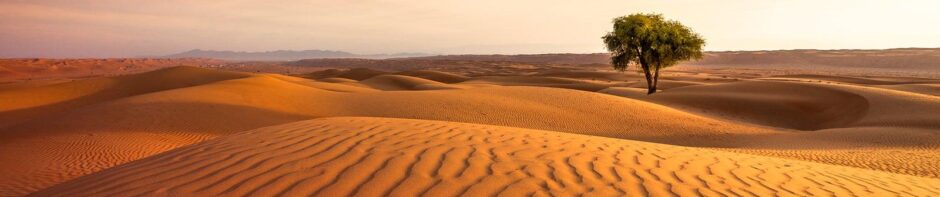E. Minassian
Ein wenig Hintergrund
2009 lebte ich drei Monate lang im Stadtteil Tadamon, einem Vorort von Damaskus. Ich wohnte bei einem jungen Kurden, der sowohl das syrische Regime als auch die PKK wegen ihrer Verbandelung hasste. Mit einem wertlosen Abschluss in der Tasche träumte er davon, nach Europa zu gehen. Ich verbrachte meine Tage im Stadtteil/Lager Yarmouk, das an Tadamon grenzt, wo ich mit einer kleinen, sich ständig verändernden Gruppe junger Palästinenser aus dem Lager zusammen war: Sie stammten aus Arbeiterfamilien mit wenig religiösem Hintergrund, waren politisiert, weltoffen, rauchten Haschisch, flirteten mit ausländischen Mädchen (oft englischsprachigen), waren pleite, wollten Künstler werden und versuchten alle, dem Militärdienst zu entgehen.
Tadamon war ein „informelles” Viertel: Während einige Gebäude Eigentumsurkunden hatten, waren 90 Prozent ohne Genehmigung gebaut worden. Die Bevölkerung bestand aus Arbeitern, die aus der Agrarregion Ghouta rund um Damaskus gekommen waren, ehemaligen Bauern, die sich ein oder zwei Generationen zuvor der industriellen Reservearmee der Großstadt angeschlossen hatten. Offiziellen Statistiken zufolge hatte Tadamon 80.000 Einwohner, weniger offizielle Quellen sprachen jedoch von 200.000 Menschen.
In diesem Vorort war die Kontrolle durch das Regime weniger sichtbar – eine „Peripherie“, wie Soziologen es nennen, die stets darauf bedacht war, sich auf der richtigen Seite der Grenze zu bewegen. Im Jahr 2011 begannen sich Gruppen zu bilden. Sie bewaffneten sich nach und nach, und das Viertel entzog sich vollständig der Kontrolle der Sicherheitskräfte. Bis 2012 war die Hälfte von Tadamon in den Händen der Aufständischen. Im Jahr 2013 kam es zu einem schrecklichen Massaker: 280 Zivilisten wurden vom Militärgeheimdienst entführt und hingerichtet, ihre Leichen in Massengräbern verbrannt. Dies war nur die Spitze des Eisbergs von Entführungen, Morden, Erpressungen, Bombardierungen und Zwangsräumungen, die das Viertel sechs Jahre lang heimsuchten.
Im Jahr 2018 gewann das Regime die Kontrolle über Tadamon zurück, das nun fast vollständig von seinen Bewohnern verlassen und zu einer Ruine geworden war. Im selben Jahr, als die meisten bewaffneten Gruppen in der Gegend um Damaskus und Daraa ihre Waffen abgaben, zwang das Dekret Nr. 10 von 2018 Flüchtlinge, die aus ihren Häusern geflohen waren, Eigentumsurkunden vorzulegen, um zurückkehren zu können. In diesen selbst errichteten Stadtvierteln gab es jedoch keine Eigentumsurkunden, und das Land wurde beschlagnahmt und an regierungsnahe Unternehmen versteigert. Da es an Kapital mangelte, das Menschen investieren wollten, kam der versprochene Wiederaufbau nie zustande, und die Ruinen wurden dem Spekulationsmarkt überlassen.

Mein kurdischer Mitbewohner verließ Syrien im Frühjahr 2011, unabhängig von den Ereignissen. Er fand Arbeit als Hotelrezeptionist in Mekka. Acht Jahre später gelang es ihm, legal nach Deutschland zu kommen. Unter meinen Freunden aus Yarmouk wurden einige nach Folterungen ermordet; die meisten flohen aus dem Land, als Tadamon vom Regime in Schutt und Asche gelegt wurde.
Einige schafften es, sich ein neues Leben aufzubauen, indem sie ihre Arbeitskraft für Löhne verkauften, die nicht weit von denen der intellektuellen Mittelschicht in den Ländern entfernt waren, in denen sie gelandet waren. Doch oft fanden sie sich in der westlichen proletarischen Erfahrung wieder, mit all den damit verbundenen Entbehrungen. Aus Solidarität mit meinen Freunden und mit den Genossen und Massen, die sich 2011 den Panzern und Schlägern des Regimes entgegenstellten, habe ich aus der Ferne nie aufgehört, mir den Sturz des Assad-Regimes von ganzem Herzen zu wünschen.
Vierzehn Jahre später, lange nachdem die anfängliche Aufstandsbegeisterung abgeklungen war und der beginnende Bürgerkrieg die kleinen Kreise der extremen Linken zerschlagen hatte, ist es an der Zeit, zurückzublicken und zu versuchen, diese Sequenz unter Klassenaspekten zu analysieren. Losgelöst von politischen „Lagern“, demokratischen Projektionen und orientalistischen Interpretationen (den sogenannten „‚Communities‘“), aber auch von den revolutionären Hoffnungen, die während der Kämpfe entstanden sein mögen, was sagen die syrische Revolution, der Verlauf des Bürgerkriegs und das „neue Regime“ über soziale Klassen, Rente (im marxistischen Sinne, d.Ü.) und den Staat aus?
Der „Mittelschicht-Moment“ im Angesicht des Massakers
Im Frühjahr 2011 waren weder die Arbeiterschaft noch der Warenverkehr direkt betroffen. Die Revolution war die Demonstration selbst. Rückblickende Berichte stimmen in diesem Punkt überein: Die Demonstration war eine Blase, die Menschen unabhängig von ihrer sozialen Zugehörigkeit, ihrem Verhältnis zu Geld und ihrer Position innerhalb der Ausbeutung vereinte. Es war eine Utopie im Entstehen, die angesichts der Unterdrückung neue Formen der Solidarität hervorbrachte. Es war eine vorübergehende Aussetzung der sozialen Welt, und sie wurde auch als solche beansprucht: Die Demonstranten waren über das hinaus vereint, was sie sonst trennte. So lehnte die Subjektivität der Bewegung nicht nur jede klassenbasierte Interpretation ab (1), sondern ihre soziale Zusammensetzung ließ sich auf den ersten Blick auch nicht auf endgültige Proklamationen reduzieren, die auf bestimmte Interessen zurückzuführen waren.
Wir können jedoch feststellen, dass dieser Protest eine geografische Dimension hatte. Die ersten Aufrufe, in Damaskus und Aleppo auf die Straße zu gehen, die von jungen Hochschulabsolventen aus den Städten initiiert wurden, zogen zwar ein aktivistisches Milieu an, konnten jedoch keine großen Menschenmengen mobilisieren. Der Funke sprang in Daraa über, einer von der Intelligenz verachteten Provinzstadt, wo es nach einer weiteren Demütigung durch die Sicherheitskräfte spontan zu Protesten kam. Nach Daraa (März–April 2011) folgten massive Demonstrationen in Homs (April–Mai 2011) und Hama (Juli 2011). Dies war die Bewegung der „Stadtzentren“, die Aktivisten und Proletarier vereinte und sofort mit Massakern konfrontiert wurde. Die Repression war brutal und wurde sowohl von den Sicherheitskräften als auch von ihren Schlägern – den Shabbiha, der Reservearmee des Regimes, den hässlichsten Geistern unter den Geistern – durchgeführt, begleitet von einer beispiellosen Welle von Inhaftierungen. Die klassenübergreifende Tendenz des Jahres 2011 war weniger die Konvergenz zweier unterschiedlicher Bewegungen als vielmehr eine gemeinsame Erfahrung angesichts der Repression.

Diese Sequenz war dennoch ein „Mittelschicht-Moment“ der Revolution, der weniger in ihrer sozialen Zusammensetzung als vielmehr in ihrer politischen Perspektive erkennbar war: eine Zivilgesellschaft, die sich gegen den Staat behauptete, sich aber gleichzeitig in ihm widerspiegelte – die Idee eines Rechtsstaates, der die Verwirklichung der Individuen garantiert. Dieser Moment strebte nach der Einheit der sozialen, politischen und kommunalen Komponenten des Landes und nach einem neuen Pakt zwischen Gesellschaft und Staat, der auf der Anerkennung der Staatsbürgerschaft und ihrer „Würde“ beruhte. Er war nicht einer bestimmten sozialen Kategorie vorbehalten. Wie ein Genosse und Theoretiker schrieb: „Es macht keinen Sinn, die Mittelschicht anders als als einen Moment des Kampfes zu beschreiben.” (2) Man könnte sogar sagen, dass es 2011 der proletarische Kampf war, der dem „Mittelschicht-Moment” in Syrien seine aufständische Form gab. Das Proletariat ist ein Gespenst, das die kapitalistischen sozialen Verhältnisse heimsucht, der negative Moment des Kampfes, der sich dem politischen Pol entgegenstellt – was nicht bedeutet, dass das Proletariat darin keine Rolle gespielt hätte.
Die Unterdrückung drängte die Bewegung nach und nach in die Vororte. Die vom Staat nur unzureichend verwalteten Randbezirke wurden zum Zentrum der Revolution. Die für die kürzlich proletarisierte Bauernschaft typischen vorstädtischen Beziehungen ermöglichten in diesen Gebieten eine stärkere Selbstverteidigung als in den Stadtzentren, und die schwächere Präsenz des Staates machte sie zu sicheren Zufluchtsorten für die neuen Aktivisten, die in den ersten Wochen des Aufstands hervortraten. Eine proletarische Wende (im Sinne der sozialen Zusammensetzung) vollzog sich auch räumlich und veränderte den Charakter der Proteste. Die Utopie einer vereinten Gesellschaft, die eine politische Revolution forderte, stand nun vor der konkreten Frage der Selbstverwaltung in den vom Regime befreiten Gebieten.
Die „mittelständische” Färbung der Revolution erlitt einen Rückschlag, aber der klassenübergreifende Charakter der Bewegung blieb bestehen. Dies war der Beginn einer zweiten klassenübergreifenden Phase, in deren Mittelpunkt die Frage der Selbstverwaltung der Gesellschaft stand – also vor allem die Gestaltung der Klassenverhältnisse.
Der Staat als Beute
Betrachten wir zunächst, wie das syrische Regime auf die Bewegung reagierte, mit der es 2011 konfrontiert war: Einerseits mit Massakern und der rasanten Zerstörung des städtischen Gefüges, andererseits mit dem Einsatz politischer Renten, um seine Position in Teilen des Proletariats zu stärken.
In der marxistischen Literatur finden wir eine Definition des modernen Staates als „Bande bewaffneter Männer“, die mit den Überlegungen des jungen Marx zum Staat als einer „von der Zivilgesellschaft getrennten“ sozialen Form und als „Ausschuss zur Verwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten der Bourgeoisie“ koexistiert. Bei der syrischen Revolution ging es in ihrer „bürgerlichen“ Phase im Wesentlichen um den Versuch, von Ersterem zu Letzterem überzugehen: von der Aneignung des Staates durch einen kapitalistischen Clan als Instrument der Ausbeutung zu seiner Loslösung von Partikularinteressen und seiner Umwandlung in ein Instrument der Regulierung. Dieser Versuch schlug fehl: In Syrien ist die Staatsform der „bewaffneten Bande“ tief in den grundlegenden sozialen Beziehungen verankert. Es ist daher notwendig, einen erneuten Blick auf die Sozialgeschichte zu werfen.
In den 1980er Jahren ordnete Michel Seurat die Klassenanalyse des syrischen Staates unter der Assad-Familie der Analyse der sozialen Formation und Macht unter, wobei er Konzepte aus der mittelalterlichen Soziologie von Ibn Khaldun verwendete: Eine militärische Kraft außerhalb der dominierenden städtischen Gesellschaft, die aus soziodemografischen Randbereichen hervorgeht und durch „primäre Bindungen“ (Asabiyya) verbunden ist, übernimmt die Macht im Staat und macht ihn zu ihrer Beute. In Khalduns Schema soll sich diese Asabiyya in der von ihr eroberten sozialen Formation (der städtischen Zivilisation mit ihrer Arbeitsteilung und der Übertragung öffentlicher Angelegenheiten an ein separates Gremium) auflösen. Wie Seurat jedoch beobachtete, blieb diese Beziehung zum Staat als Beute in Assads Syrien jedoch bestehen, was zu einer Situation führte, in der die Existenz des Staates in seiner „modernen” Form (als von der Gesellschaft getrennte Instanz) infrage gestellt wurde (3). Da Erklärungen, die auf Barbarei oder mittelalterlichen Gesellschaftsformen basieren, ihre Begrenzungen haben, brachte Seurat dann die Geschichtlichkeit ins Spiel: Er wies darauf hin, dass die Funktionsweise des Staatsapparats in eine sozioökonomische Struktur eingebunden war, die weit von Khalduns Schema entfernt war, nämlich die Zirkulation von Rentenkapital.
Diese Rente entstand ursprünglich aus der Abtretung von Öleinnahmen durch die Golfstaaten im Namen der Unterstützung der palästinensischen Sache, wurde jedoch, sobald sie vom syrischen Staat vereinnahmt wurde, autonom. Sie war stets instabil und manifestierte sich in einem Kontext geopolitischer Polarisierung, in dem Staaten keine sozialen Blöcke bilden, auf der Ebene von Dörfern, Stadtvierteln und Verkehrskreisläufen. Sie barg ständige politische Gewalt in sich: Um sich den Zugang zu Sicherheitsrenten zu sichern, hatten die Begünstigten jedes Interesse daran, verschiedene geopolitische Kanäle gegeneinander auszuspielen und Mikro-Logiken der regionalen Destabilisierung zu schüren, um für die Aufrechterhaltung einer Art Ordnung unverzichtbar zu werden. Auf diese Weise zeigte das syrische Regime immer wieder seine Fähigkeit, Unruhe zu stiften, um sich eine kontinuierliche Finanzierung zu sichern, während die Sicherheitsrente durch eine Welt von Subunternehmern sowohl der Unordnung als auch der Ordnung nach unten sickerte und gleichzeitig in den Handel mit Drogen und Waffen investiert wurde, dessen Geschäft notwendigerweise mit dem Sicherheitsapparat und seinen Klientelen verbunden war.
Diese Klientele, die in Clans und religiöse Gruppen fragmentiert war, ersetzte nach und nach die „Massen“ als soziale Basis des Parteistaats. Zwei Jahrzehnte lang (in den 1960er und 1970er Jahren) bot die Rente eine Form der proletarischen Reproduktion, die vom Staat garantiert wurde: eine Ära der massenhaften Beschäftigung im öffentlichen Dienst und in verstaatlichten Industrien, begleitet von syrischem „Nationalismus“. Ab den 1980er Jahren geriet die Reproduktion des Proletariats als Lohnklasse jedoch in eine Krise, und das Regime hielt seine Macht durch Massaker aufrecht. In deren Folge übernahmen bewaffnete Banden alawitischer Herkunft, die sich zu konkurrierenden Sicherheitsdiensten zusammengeschlossen hatten, ganze Wirtschaftszweige, die vom Staat aufgegeben worden waren. Privatisierungen und der Zusammenbruch des Parteistaats in mafiös geführte Unternehmen führten zur Vertreibung von Hunderttausenden von Proletariern in den informellen Sektor; das Ende der staatlichen Unterstützung für die Landwirtschaft löste die Proletarisierung der Bauernschaft aus. Die wiederkehrenden Dürren in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre verschärften dieses Phänomen, und selbstgebaute Vororte breiteten sich um die städtischen Zentren herum aus.
Die Bärte der klassenübergreifenden Allianz
Die Rente und ihre Realisierung in Form des Staates als Beute wurden zum roten Faden der sozialen Dynamik der Revolution und des Bürgerkriegs und führten nach 2011 zu verschiedenen Formen klassenübergreifender Politik.
Zunächst einmal war es weniger die Revolution als vielmehr das Regime selbst, das darauf bedacht war, jeden Versuch der Bourgeoisie, sich als vereinigender Pol zu konstituieren, im Keim zu ersticken. Diese Versuche waren ebenso schwach wie die Klasse selbst: Die kommerzielle Bourgeoisie, die größtenteils sunnitisch war – und daher am Rande der Sicherheitskreise stand, die aus dem Alawiten-Pool rekrutiert wurden –, blieb dem Regime lange Zeit treu, da sie nicht die Kraft hatte, sich ihm zu widersetzen. Mehreren Quellen zufolge versuchte die Bourgeoisie im Sommer 2012 eine Kehrtwende, als Rebellengruppen kurz davor standen, Damaskus und Aleppo einzunehmen, aber da das Regime nicht zusammenbrach – und angesichts der Drohung, den „Hamidiyah-Souk zu zerstören“ (der Bazar von Damaskus, dem ‘Sitz’ der Bourgeoisie, d.Ü.) – fiel diese Bourgeoisie schnell wieder in die Reihe zurück.
Vor allem war es die Logik des Rent-Seeking, die die räumliche Teilung prägte und die Revolution in die Vororte drängte. Die Trennung zwischen einer „nützlichen“ Zone und einer sekundären Zone, die Massakern und Zerstörung ausgeliefert war, spiegelte die Struktur der kapitalistischen Profite wider: Produktionsstätten (Fabriken, die sich in Randgebieten konzentrierten) wurden zugunsten von Zirkulationskreisläufen geopfert, durch die regionale und inländische Kapitalisten ihre Einkünfte erzielen konnten. Gleichzeitig beschleunigte diese territoriale Segmentierung die Umwandlung des syrischen Proletariats in eine Surplus Bevölkerung, die aus der Lohnarbeit und aus der Wirtschaft selbst verdrängt wurde.
In den vom Regime „aufgegebenen“ Gebieten existierte der Staat nicht mehr: Nur noch mit Macheten bewaffnete Schläger, die Überfälle verübten, um sich schlugen und Bashar als ihren Gott verehrten – hinter dieser Barbarei standen Institutionen, die in ihrem Kielwasser folgten. Der Staat musste an diesen Orten aus der Gesellschaft heraus geschaffen werden, aus der Vertiefung der alltäglichen sozialen Beziehungen in Nachbarschaften, die unter ständiger Bedrohung durch Repression standen.
In den „befreiten“ Zonen entstanden Administrationen, die versuchten, eine Form der Regulierung zu verkörpern, die in der „Gesellschaft“ verwurzelt war. Diese zivilen Autoritäten, gefördert von den Neo-Aktivisten der ersten Mobilisierungswelle, versammelten tatsächlich einen ganzen sozialen Sektor um sich, der sich aufgrund dieser räumlichen Segmentierung der Revolution „anschloss“ und bald ihre faktische Führung bildete: mittlere Beamte, Anwälte, Unternehmer und eine Armada von „Scheichs“, die aufgrund ihres „islamischen“ Charakters eine aus der Gesellschaft hervorgehende Beziehung zur Gerechtigkeit verkörperten
Der Islam wurde zu dem Raum, den die Staats-Bande der Gesellschaft offen ließ, ein Raum, in dem er sich als Garant der Gerechtigkeit profilieren konnte, um die Beziehungen zwischen den sozialen Klassen zu organisieren. Er wurde auf unterschiedliche Weise von sozialen Gruppen instrumentalisiert, die im Namen der „Gesellschaft” an die Stelle des Staates treten wollten. Die zivilen Autoritäten verkörperten in ihrem Streben nach „gerechter” Regulierung unter Berücksichtigung der bestehenden sozialen Segmentierungen die ersten dieser „Bärte”. Doch bald schon sollten sie mit einer anderen Art koexistieren, die in einen Kampf auf Leben und Tod mit der Staats-Bande verwickelt war: den bewaffneten Gruppen.
Die Militarisierung des Aufstands begann mit der massiven Desertionswelle im Sommer 2011, durch die nicht nur Waffen, sondern auch eine große Zahl mittelloser Proletarier (Deserteure konnten nicht nach Hause zurückkehren) in die Aufstandsgebiete gelangten. Zunächst handelte es sich bei diesen Milizionären um Proletarier ohne feste Strukturen: Sie wurden nicht bezahlt, wechselten von Gruppe zu Gruppe und schufen ihre eigene militärische Führung, um sich den Versuchen zu widersetzen, sie dem Pseudokommando der Freien Syrischen Armee (FSA) unterzuordnen, die in der Türkei als Vermittler ausländischer Mächte und finanzieller Sponsoren gegründet worden war. Diese bewaffneten Proletarier blieben ihren lokalen Communities (Nachbarschaften und Städten) verbunden und ließen sich weiterhin von der Vorstellung eines „Staates der Gerechtigkeit” inspirieren. Auf diese Weise koexistierten zwei Jahre lang in allen Aufstandsgebieten, die vom Regime belagert und bombardiert wurden, die zivile Dynamik (urban und kleinbürgerlich) und die Miliz-Dynamik (bäuerlich und proletarisch) so gut es ging.
Das Aufkommen der „bewaffneten Gruppe” in der Klassendynamik der syrischen Revolution führte jedoch zu einer doppelten Bewegung. Einerseits stellte sie eine Autonomisierung des Surplus Proletariats und seiner Handlungslogik dar, andererseits kehrte sie zu den sozialen Beziehungen der Rente zurück und widersprach damit der klassenübergreifenden Vorstellung vom „Staat der Gerechtigkeit”.
Proletarische Massaker vs. progressive Führung: Der soziale Widerspruch und sein ‘Holding-Pattern’
Da es zu keinem entscheidenden Sieg gegen das Regime kam, nahm der proletarische Befreiungskrieg zunehmend einen eschatologischen und rachsüchtigen Charakter an. Daesh trat somit als paroxysmaler Ausdruck des proletarischen Exodus aus der revolutionären klassenübergreifenden Politik (2011 bürgerlich, 2012–2013 islamisch) hervor:
Die Idee von Daesh war es, … arme Stadtviertel zu infiltrieren und Gruppen oder Einzelpersonen zu identifizieren, die sich gedemütigt oder frustriert fühlen könnten. … Es gab eindeutig ein Element der Klassenrache, das Daesh sehr effektiv ausnutzte und das der Rest der Opposition völlig ignorierte. Der Islamische Staat nährte sich von denen, die von der Revolution zurückgelassen worden waren. Die FSA wurde davon überrascht. (4)
Die „Barbarei“ von Daesh und seine Fähigkeit, sich mit Waffengewalt gegen etablierte soziale Hierarchien durchzusetzen, stehen in krassem Gegensatz zu den Versuchen der Anführer, die behaupten, die „Zivilgesellschaft“ zu vertreten, das Proletariat für sich zu gewinnen.
Der islamische Bart dient seit langem als symbolisches Mittel für aufstrebende Staatsgründer, um sich die Aktivitäten des männlichen Proletariats zu geringen Kosten anzueignen. Diese Vorgehensweise stößt jedoch an ihre Grenzen, wenn sich Letzteres nicht gegen seine eigene Reproduktion als Klasse innerhalb dieser Gesellschaft wendet, sondern gegen die „Gesellschaft” selbst – verstanden als die befriedete Formalisierung sozialer Beziehungen. Daesh bietet einem Teil des männlichen Proletariats, das zu einer Klientel von Handlangern geworden ist, eine soziale Zwangsmacht, die die auf dem Zugang zu Pachtzinsen beruhende Herrschaft kompensiert: die Macht des Phallus, die Freiheit der Waffe und die Plünderung, alles eingebettet in eine grandiose eschatologische Erzählung, die die Ideale der sozialen Reproduktion ersetzt, die von „repräsentativen“ Institutionen reguliert werden.

Dennoch bleibt Daesh eine Neuzusammensetzung des klassenübergreifenden Bündnisses. Die Bewegung entkommt weder der Renten-Ökonomie noch der Anziehungskraft des Staates. Die proletarische „Barbarei“, auf der Daesh beruht, ist nicht den „revolutionären“ Mittelschichten untergeordnet, sondern dem Gespenst der Mittelschichten der Vergangenheit: denen, die in den 1970er Jahren die Kontrolle über den Renten-Staat übernommen hatten. Dieser neue Zustand der Barbarei verkörpert perfekt die khaldunische ewige Wiederkehr im baathistischen Stil: eine Rentier-Bande, die sich als Staat neu gegründet hat. Der IS repräsentiert eine soziale Formation, in der die irakischen Mukhabarat „aus der Wüste” ihre Praktiken der Ausbeutung und Massaker unter dem schwarzen Banner des Dschihadismus verbreiteten und sich einer neuen proletarischen Klientel anschlossen – nur um gemeinsam mit ihr unterzugehen.
Angesichts des Monsters, das durch die Niederlage des klassenübergreifenden revolutionären Prozesses entstanden war, wurde die Idee einer bewaffneten Demokratie wieder aufgegriffen – allerdings für den Export – von einer politischen Kraft, die außerhalb der revolutionären Bewegung entstanden war, aber über echte Fähigkeiten zur Führung des Proletariats verfügte: die PKK. Seit 2012 hat sie mit dem Segen des Regimes die Kontrolle über kurdische Enklaven in Nordsyrien übernommen und im Rahmen des Kampfes gegen den IS unter dem Schutz der USA ihre territorialen Besitztümer erweitert. Die in diesen Gebieten errichteten „demokratischen” Strukturen sind in keiner Weise das Produkt proletarischer Dynamiken. Sie fungieren als Vermittler zwischen „Gemeinschaften”, die die PKK selbst weitgehend neu konfiguriert hat, um proletarische Widersprüche zu neutralisieren, indem sie diese durch ein Regierungssystem verwaltet, das direkt aus kolonialer Logik hervorgegangen ist und sich auf ethnische und stammesbezogene Strukturen und Loyalitätsketten stützt.
Nord-Syrien erscheint somit, einmal befreit von den „barbarischen“ Formen der Rente, als eine vorübergehende soziale Formation in den Händen der politisch-militärischen Kader der PKK. Ihr Überleben hängt von endlosen Verhandlungen mit den „Gemeinschaften“ unter ihrer Autorität ab, vor allem aber mit externen militärischen Akteuren, die im Austausch für ihre territoriale Präsenz ihren Schutz garantieren. Letztendlich bleibt es eine andere Form der Rente, von der allein die Führung profitiert. Das Proletariat im nordöstlichen „Kommunalismus“ wird durch den Schutz eines Staatsapparats entschädigt, der keine Massaker verübt, kaum enteignet und selbst von anderen Kadern von außen kontrolliert wird.
Dies ist das Gegenteil der proletarischen Utopie der Rache: eine „Revolution“, die außerhalb der sozialen Klassenverhältnisse stattfindet.
HTS: Das Streben nach einem „separaten Staat”
Ab 2016 verschob sich das militärische Kräfteverhältnis eindeutig zugunsten des Regimes, das von Russland und dem Iran unterstützt wurde. Dennoch war das Regime weniger denn je in der Lage, das Proletariat auf andere Weise als durch die Integration in seine eigenen Milizen zu reproduzieren. Die Proletarier in den zurückeroberten Gebieten fanden sich aus der Wirtschaft ausgeschlossen und waren ärmer denn je: Sie hatten keinen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung und konnten nicht einmal die Landeswährung verwenden, um sich Lebensunterhalt zu kaufen. Die Unterdrückung selbst wurde zu einem Geschäft, da konkurrierende Sicherheitsapparate sich durch Erpressung finanzierten.
Die „Idlib-Tasche“ wurde somit zum letzten Zufluchtsort der „Rebellen“. Immer wenn das Regime Gebiete zurückeroberte, organisierte es die Massendeportation der Bevölkerung nach Idlib – und verwirklichte damit sein Vorhaben, ein Surplus Proletariat zu vertreiben, das sowohl eine Belastung als auch eine Bedrohung darstellte. Doch diese Enklave, in der drei Millionen Flüchtlinge Zuflucht fanden, begann sich auch als erster Entwurf eines aus der Revolution hervorgehenden Staates zu formieren. Paradoxerweise ging die hegemoniale Militärmacht in Idlib – Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), die zwischen 2017 und 2019 ihre Rivalen eliminierte – aus der Al-Nusra-Front hervor, einer Gruppe, die ihre soziale Macht ursprünglich aus der Ablehnung jeglicher Kompromisse mit den zivilen Institutionen der „revolutionären Gesellschaft“ bezog. Während Al-Nusra als bewaffnete Gruppe außerhalb des revolutionären Projekts und seiner Widersprüche stand, setzte sich HTS allmählich, wenn auch nicht ohne Reibungen, als eine „von der Zivilgesellschaft getrennte” soziale Formation in Idlib durch.
Die Institutionen in Idlib integrierten die herrschenden Klassen, ohne jedoch einer ihrer spezifischen Fraktionen anzugehören. Sie setzten die territorialen Ambitionen der Warlords außer Kraft und bremsten gleichzeitig die räuberischen Aktivitäten der Proletarier, die sich bewaffneten Gruppen angeschlossen hatten. Diese Formation war weder ein bloßes Instrument der Plünderung noch ein utopischer Versuch, die Gesellschaft demokratisch zu vertreten. Selbst als die Demonstrationen – sowohl gegen das Regime als auch gegen HTS (5) – anhielten, ging der embryonale Staat in Idlib gleichzeitig repressiv und kooptierend vor. Er sperrte Bedrohungen ein, verhandelte mit Demonstranten, verteilte Posten unter den Elitefraktionen, verwaltete Kapitalflüsse und baute Allianzen auf, ohne sich einer ausländischen Macht unterzuordnen.

Diese soziale Formation in Idlib war mehr als nur eine bewaffnete Gruppe. Im November und Dezember 2024 stellte sie ihren inneren Zusammenhalt unter Beweis, indem sie innerhalb weniger Tage die Kontrolle über das Land übernahm – und damit das Regime selbst in puncto innerer Geschlossenheit übertraf. Um die Cliquen zu besiegen, die die Märkte unter sich aufteilten und die Aufgabe der Reproduktion der verschiedenen Fraktionen des Proletariats unter sich aufteilten, war es unerlässlich, über einen fertigen Staatsapparat zu verfügen: selbst konstituiert, distanziert vom revolutionären Umbruch und seinen Widersprüchen. Gerade als es so aussah, als sei die Idee eines syrischen Staates – als nationaler Rahmen für die Reproduktion sozialer Beziehungen – ein für alle Mal zusammengebrochen, tauchte sie nach dem Sturz des Regimes plötzlich als möglicher Horizont wieder auf.
Capital Fix & Capital Shoot
Im Dezember 2024 erlebte der revolutionäre Moment eine seltsame Rückkehr. Der Zusammenbruch des Regimes schien das Ende der Revolution zu bedeuten – nämlich die Befriedung der Zivilgesellschaft. Da sie nun nicht mehr verfolgt wurde, konnte die Gesellschaft davon absehen, sich in die Angelegenheiten des Staates einzumischen. Als selbstregulierte Aktivität „des Volkes” erlebte die Revolution ihre letzten Zuckungen in den Stunden unmittelbar nach dem Sturz des Regimes: eine seltsame Mischung aus Plünderungen und dem friedlichen „Einbruch” des Proletariats in die Machtzentren, während die (Klassen-)„Gesellschaft” unberührt blieb. Sehr schnell absorbierte die HTS das „Versprechen der Staatlichkeit” in ihren politisch-militärischen Apparat.
Bei diesem Versprechen der Staatlichkeit – dessen „demokratischer“ Charakter kaum eine Rolle spielt – ging es nicht um proletarische Rache oder eine zivile Utopie. Vielmehr ging es um die Loslösung von den Partikularinteressen mafiöser Cliquen. Für die Bourgeoisie lag das Versprechen in einer Form erneuerter und „garantierter“ Autonomie, für das Proletariat in einer Rückkehr zur normalen Ausbeutung, ohne die Gefahr der Entführung durch einen Mafia-Staat oder der vollständigen Ausgrenzung aus der Wirtschaft.
Doch dieses Versprechen ist illusorisch, wie die jüngsten Ereignisse bestätigt haben. Wenn das Management der Renten durch das Assad-Regime durch den lokalen Kontext geprägt war, so ist die Aneignung des Staates durch bewaffnete Banden keine kulturelle Anomalie. Sie hat sich sowohl als Bedingung als auch als Grenze der bürgerlichen Revolution in der Region herausgestellt. Heute ist sie Teil der Umstrukturierung der kapitalistischen Beziehungen unter dem Druck der globalen Krise der Wertsteigerung und des Mangels an Mehrwert.
In Syrien lassen sich die aus Sicht kapitalistischer Investitionen profitablen Sektoren an einer Hand abzählen: Bauwesen, Rohstoffgewinnung, Transport von Waren (und deren Schutz), Drogenhandel und der Handel mit der Loyalität von Milizen gegenüber ausländischen Mächten (6). Keiner dieser Sektoren gehört zum „produktiven“ Bereich; alle haben eine Rentier Dimension. Diese Märkte sind von staatlich vermittelten Positionen abhängig – nicht als Instanz der Regulierung, sondern als Verteiler von Monopolen. Der Wettbewerb zwischen Kapitalisten in einer solchen Konstellation wird durch rohe Gewalt und Allianzen mit anderen rohen Kräften entschieden. Innerhalb dieser Struktur verschwimmt die Grenze zwischen Proletariern und Handlangern zunehmend.
Der Sturz des syrischen Regimes fiel mit einer globalen Krise zusammen, in der der Kampf um die Rentenmärkte mit einer spektakulären Erosion der Staatsform einherging, die auf die Regulierung des kapitalistischen Wettbewerbs ausgerichtet war. Der Staat, der sich „von den einzelnen Kapitalisten unterscheidet“ (ein nie erreichtes Ideal), ist einem Staat gewichen, der zunehmend von bestimmten kapitalistischen Gruppen vereinnahmt wird, die unter der ständigen Bedrohung durch bewaffnete Gewalt um extraktivistische, landbasierte und spekulative Märkte konkurrieren. Dieser „Zustand der Barbarei“ tendiert dazu, sich auf globaler Ebene durchzusetzen – nicht als archaische Form, sondern als Paradigma einer Krise des Mehrwerts, die ihr Heil in Gewinnen sucht, die sich um Rentenpositionen herum strukturieren.
Während die Reproduktion des Proletariats in den Kernzonen der Akkumulation nach wie vor ein zentrales Anliegen des Staates ist, sieht die Situation in den Peripherien radikal anders aus, wo die Frage der Surplus Proletarier und ihrer Reproduktion immer offener durch Massaker gelöst wird – wobei letztere selbst zu einem Moment des Profits werden. Die Zerstörung Gazas kann somit als globalisiertes Pendant zur Zerstörung syrischer Vororte gelesen werden.
Im Nahen Osten scheint sich der proletarische Aufstand von 2010 – schwach in seiner Offensivkraft, aber hartnäckig in seinen Erscheinungsformen – zu einer endlosen militärischen Umstrukturierung zu entwickeln, bei der Israel erneut an vorderster Front steht. Die notwendige Unterordnung der Nationalstaaten unter diese Umstrukturierung macht das „Versprechen der Staatlichkeit“ obsolet. Diese Unterordnung, verbunden mit der militärischen Kontrolle der peripheren Bevölkerungsgruppen, führt zu einer „kommunitären Verwaltung“ des Proletariats nach klassisch kolonialen Vorbildern (Israel als „Beschützer der Drusen“ und vielleicht bald auch der Kurden). Gleichzeitig eröffnet sie neue Märkte für Investitionen auf Kosten des „formell” lohnabhängigen Proletariats, indem sie eine „wettbewerbsfähige Marktwirtschaft” verspricht, die durch die Privatisierung der noch unter staatlicher Kontrolle stehenden Industrieunternehmen gesichert wird. (7)
Auf der anderen Seite der Ringstraße
„Es ist seltsam, das zu sagen, aber während des Krieges war alles einfacher. Wir haben uns mehr umeinander gekümmert. Jetzt ist jeder auf sich allein gestellt.“ (8)
Obwohl der Sturz des Regimes den Kampf der „Mittelschicht“ von 2011 kurzzeitig wiederbelebte, hat die Mittelschicht von der neuen Ordnung wenig zu erwarten. Sie kann endlich ohne Lebensgefahr in die Öffentlichkeit eingreifen und erneut die Fahne der Demokratie und Zivilgesellschaft vor den bärtigen Milizionären hissen, die den Präsidentenpalast besetzt halten. Doch als sie allmählich erkennen, dass ihr Engagement keinen Einfluss auf die Staatsform hat, ist ihre Niederlage stumpf und glanzlos – wie eine verlorene Schlacht, geschmückt mit den Insignien des Sieges, beraubt sogar des bittersüßen Trostes kollektiver Nostalgie.
Das Surplus Proletariat aus den Randbezirken und mittelgroßen Städten am Rande des „nützlichen Syrien“ hat nichts mehr in Form eines „Staates der Gerechtigkeit“ zu erwarten. Auch nach dem Sturz Assads bleibt es aus der Wirtschaft verdrängt, auf Exil oder Flüchtlingslager beschränkt und darauf angewiesen, von humanitärer Hilfe und familiärer Unterstützung zu leben. Es ist zunehmend von neuen Gewaltzyklen abhängig und findet Arbeit als Handlanger für bewaffnete Kapitalisten, die um den Zugang zu Rentiermärkten konkurrieren.
Anmerkungen
- Auf eine Ankündigung der Regierung, die Löhne zu erhöhen, antworteten die Demonstranten mit dem Slogan „Das syrische Volk ist nicht hungrig“.
- Carbure-Blog, übersetzt aus dem Französischen, https://web.archive.org/web/20211026174508/https:/carbureblog.com/2016/11
- „Die Originalität der syrischen Politik im Vergleich zu anderen Ländern der Dritten Welt … liegt darin, dass sie nicht das Merkmal eines Staates ist, sondern in den meisten Fällen dessen Negation.“ (1984)
- Ein Einwohner von Raqqa, zitiert in Syria: Anatomy of a Civil War.
- „Am 15. März versammelten sich Tausende Demonstranten auf dem zentralen Platz der Stadt Idlib, um den dreizehnten Jahrestag des syrischen Aufstands zu begehen, und skandierten ‘Das Volk will den Sturz von Al-Joulani’, womit sie den ikonischen Slogan des ‘Arabischen Frühlings’ wiederbelebten (Orient XXI, 25. April 2024).
- Amer Taysir Khiti ist ein gutes Beispiel für einen syrischen Kapitalisten, der aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen ist. Er begann im Import-Export-Geschäft mit Gemüse. Im Jahr 2011 stieg er über die Hisbollah in das Captagon-Geschäft ein. Gleichzeitig betrieb er Schmuggel mit der syrischen Armee in Rebellengebieten. Dies führte zu einem Konflikt mit dem Assad-Clan. Im Exil investierte er erneut in Immobilien in der Türkei, während seine Brüder Führungspositionen in islamistischen Rebellengruppen in Ghouta und bis nach Idlib innehatten. 2018 versöhnte er sich mit dem Regime und kehrte nach Syrien zurück. Er gründete Import-Export- und Autovermietungsunternehmen und stieg in den Handel mit Kryptowährungen ein. Als gewählter Abgeordneter erwarb er durch Auktionen, die mit Beschlagnahmungen durch das Regime einhergingen, kostengünstig Grundstücke, die er als Stützpunkte für den Handel mit Captagon nutzte. Der Sturz des Regimes brachte ihn in eine schwierige Lage, aber er war nicht aus dem Spiel: Er blieb irgendwo in Syrien versteckt und „wartete auf eine Vereinbarung mit den neuen Behörden, um [seine] Aktivitäten wieder aufzunehmen“. Amer Taysir Khiti ist keine obskure „mafiaähnliche“ Figur, die in einer „parallelen“ Wirtschaft verwurzelt ist und der man die Figur eines „guten Kapitalisten“ gegenüberstellen könnte, der sich an die Regeln des Marktes und des Wettbewerbs hält: Er steht im Zentrum der Wertschöpfungsketten, die seit fünfzehn Jahren in Syrien funktionieren.
- Nach dem demokratischen Bart des „Rechtsstaats“, nach dem proletarischen und rachsüchtigen Bart des „Plünderungsstaats“ ist nun die Zeit für den „realistischen“ Bart gekommen: Er stammt von Al-Qaida und ist bereit, sich den internationalen kapitalistischen Institutionen zu unterwerfen. Ein Beweis, falls es jemals eines solchen bedurfte, dass „Islamismus“ als Ideologie oder politisches Lager nicht existiert: Hinter den Manifestationen dieser „Sprache“ muss man immer nach dem sozialen Inhalt und den Klassenwidersprüchen suchen.
- Auszug aus dem Film Phantom Beirut, Ghassan Salhab, 1998.
Veröffentlicht im Oktober 2025 auf The Brooklyn Rail, ins Deutsche übertragen von Bonustracks.