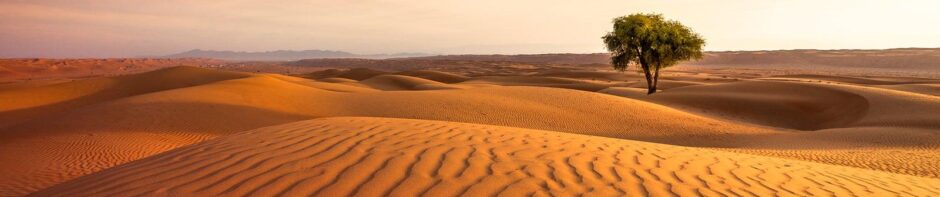Antonio Casano
Wir freuen uns, diese von Antonio Casano verfasste Erinnerung an Toni Negri zu veröffentlichen, die nicht nur eine Hommage an den Maestro darstellt, sondern auch die politischen und theoretischen Verbindungen rekonstruiert, die ihn und seine Genossen aus Palermo Mitte der 1970er Jahre zur Gründung der Autonomia operaia in der sizilianischen Hauptstadt veranlassten. Die Beziehung von Toni Negri zu Sizilien begann bereits in den frühen 1950er Jahren, als er mit Anfang zwanzig einen jener Momente der Klarheit erlebte, die ihn sein ganzes Leben lang begleiteten: „Während mich die Religiosität von Danilo Dolci verunsichert hatte, hatte ich einige Proletarier kennen gelernt, militante Kommunisten – sie erzählten mir von den Landbesetzungen und zeigten mir die heftigen und mächtigen Implikationen der bäuerlichen Klassenkämpfe […] als die Carabinieri mich aus Partinico verjagten, wurde meine Blauäugigkeit einen Moment lang unerträglich. Als ich die Berge oberhalb von Palermo überquerte, erlebte ich einen jener jugendlichen Momente der Klarheit in der Rebellion, die ein Leben lang Bestand haben. Man muss rebellieren, es ist richtig, zu rebellieren. Das Elend war unerträglich. Ich musste also die Arbeiterbewegung kennen lernen – und den Sinn für Gerechtigkeit und Veränderung neu interpretieren, indem ich ihn mit einem realeren Thema verband als dem, auf das ich mich bisher – allgemein und friedlich – bezogen hatte.“ Kurz gesagt, in den 1950er Jahren ist es Sizilien, das Toni Negri zur Veränderung antreibt, während es in den 1970er Jahren, wie wir in Antonio Casanos Text sehen werden, Toni Negri ist, der die jungen Sizilianer zur Veränderung antreibt. Eine bereichernde Lektüre für alle (Vorwort Machina).
***
Meine „Begegnung“ mit Toni Negri geht auf das Jahr 1977 zurück. Ich glaube, dass vor dieser Zeit selbst in Palermo niemand unter den jüngeren Militanten je von ihm gehört hatte, und dass es – soweit ich weiß – in unserer Gegend keine ernsthaften Studien über die Geschichte des Arbeitertums gab, deren Relevanz wir post festum in den Arbeiterkämpfen des „heißen Herbstes“ und in der Jugendprotestbewegung der mythischen 68er entdeckten. Dies war die Geschichte, die direkt oder indirekt zu uns gehörte und die in den Debatten des palermitanischen Territoriums der Autonomia wieder aufgegriffen wurde. Der Operaismo ermöglichte es uns, uns die Essenz wieder anzueignen, die in den Maschen des Gruppensektierertums gefangen geblieben war, in dem wir eine wesentliche Abweichung von dem spürten, was das Experiment von Potere operaio gewesen war. Wir wussten von einer generischen Selbstauflösung, es genügt zu sagen, dass in der Blütezeit des mehr oder weniger revolutionären Außerparlamentarismus fast alle politischen Formationen der sechziger Jahre ihren Sitz in der Stadt hatten, mit Ausnahme von Potere Op., das nie einen hatte; vielleicht gab es einen zaghaften Versuch, der den Zeitraum eines Vormittags überdauerte.
Aber das Ende der Organisation der Arbeiterbewegung schlechthin, die ’73 beschlossen hatte, ihre Aktivitäten zu beenden, erweckte großes politisches Interesse, vor allem bei den Genossen, die wie ich mit großem Einfühlungsvermögen die verschiedenen Erfahrungen der über die Halbinsel verstreuten Autonomia operaia betrachteten. In dieser Zeit waren die Opuscoli Marxisti eine große Hilfe für uns.
In der Debatte des Rosolina-Kongresses haben wir – zusammen mit den anderen Genossen der Autonomia operaia, die der Position von Negri anhingen, der die politische Aufgabe der alten Pot. Op. weiterführte – einen entscheidenden analytischen Sprung in Richtung des Beginns einer neuen Phase erkannt: Einerseits nahmen wir die Transformationen des kapitalistischen Produktionssystems zur Kenntnis, das mit dem Beginn des Umstrukturierungsprozesses die Zentralität des Arbeiters durch die Einführung von immer massiveren Automatisierungsmaßnahmen anstelle der Arbeitskraft depotenzierte, begleitet von der Dezentralisierung des Produktionszyklus weg von der großen Fabrik, um so in ein gesellschaftlich weit verbreitetes Mikrounternehmertum zu investieren. Zum anderen richteten wir unseren Blick auf die neuen Widerstandsformen von unten und versuchten, die theoretischen Schritte zu verstehen, die die Instanzen des arbeiter-gesellschaftlichen Kampfes verbinden könnten. Kurz gesagt, die Selbstauflösung von Potere operaio war in unserer Vorstellung der Akt, der das Ende der Klassenzusammensetzung um die Fabrikstadt herum markierte, indem man stattdessen den gesamten sozialen Raum der Fabrikstadt als neues Terrain der Neuzusammensetzung der revolutionären Konfliktualität betrachtete, von der das Jugendproletariat die fortgeschrittenste Manifestation war.
Generell ist festzustellen, dass die Erfahrung von Pot.Op. im gesamten Bereich der Autonomia der palermitanischen Bewegung als Ausnahme gegenüber den anderen außerparlamentarischen Gruppen wahrgenommen wurde, ebenso wie das Urteil über Lotta Continua, die 1976 aufgelöst wurden und bei der fast alle ihre Anhänger – viele im kreativen Bereich – aktiv am Schicksal der autonomen Bewegung teilnahmen, weniger barmherzig war. Stattdessen wurde mit dem, was von den Gruppenformationen übrig blieb, eine tiefe Furche aufgerissen, angesichts des opportunistischen Abdriftens, das mit der demonstrativ-proletarischen embrassons-nous unternommen wurde, die am Ende den Schwanz der PCI hielt, die immer mehr an die Schicksale der „gouvernementalistischen Rationalität“ gebunden war.
Mit der 77er-Bewegung in den besetzten Fakultäten, auch dank der selbstverwalteten Seminare und in Opposition zur herrschenden Kultur (und zur Macht, die auch von den „roten Baronen“ ausgeübt wurde), begannen neue kritische Lesarten der kapitalistischen Gesellschaft zu zirkulieren, die die gesamte Tradition der marxistischen Lehre in Frage stellten. Und angesichts des Einflusses, den Negri auf die autonome Bewegung in Palermo ausübte, wurde während der Besetzung der Fakultät für Literatur (der ersten in Italien überhaupt) eine Studiengruppe zu La forma Stato gegründet, die sich in Wahrheit mit der gesamten Literatur von Toni beschäftigte, von der akademischen bis zur militanten.
Für uns junge Genossinnen und Genossen, die wir in der bürgerlichen Studentenbewegung aufgewachsen waren, eingesperrt in den nach 1968 gebildeten außerparlamentarischen Gruppen (die Mitte der 1970er Jahre aufgrund des Grades der Bürokratisierung, in den sie geraten waren, bereits eine tiefe Krise durchliefen), war es eine echte Befreiung: Aus dieser Selbstbezogenheit fühlten wir uns in eine neue Subjektivierung hineinversetzt, in der alle Hierarchien abgebaut wurden. Vor allem aber wollte jeder von uns das volle Bewusstsein einer politischen und sozialen Praxis erlangen, die die theoretische Ebene nicht mehr von der der Militanz trennt. In gewissem Sinne wurde die autonome Bewegung zu einem wahrhaft großen Laboratorium der kollektiven Forschung, das sich gleichzeitig als eine Brutstätte menschlicher Affektivität erwies, die die Grundlagen der Mikrophysik der Macht erschütterte.
Auf diese Weise bildeten sich an den Fakultäten der Universität von Palermo auf Anregung dieser „Literatur“ weitere Formen von Tätigkeiten heraus, die nicht nur mit den konkreten sozialen Bedürfnissen der Region zusammenhingen (städtische Lebensqualität, Präventivmedizin, Situation der Jugendlichen usw.), sondern auch eine neue Art und Weise eröffneten, politische Militanz ausgehend von den eigenen Bedürfnissen und Wünschen zu konzipieren, was zum Experiment eines neuen Modells sozialer Organisation werden sollte: die Bewegung. Dieses Gebilde wurde zur Essenz einer Gemeinschaft von Singularitäten, in der das Private dem Politischen immanent war, und fegte mit einem Schlag die müde Gruppenpraxis und damit auch die Pyramidenmodelle hinweg, die aus der marxistisch-leninistischen Tradition der offiziellen Arbeiterbewegung stammten und ideologisch von Dogmatismus, Verrat und Sektierertum durchdrungen waren.
Wie aus heiterem Himmel entdeckten wir unsere Affinität zur Praxis der Autonomia, auf die sich die Kreise des Jugendproletariats, die ’77 vorausgegangen waren, informell bezogen. Im Handumdrehen erschien uns ein Teil unseres militanten Lebens (der ideologisierte) völlig fremd, während wir den Teil „selbst aufwerteten“, in dem wir direkt in die anti-meritokratischen studentischen Kämpfe eingebunden waren. Diese wurden auch außerhalb der Bildungseinrichtung als proletarische Jugendbewegung charakterisiert: siehe die legendäre „rote Woche“ von 1975, bei der die Studenten im Zentrum der Stadt (Palermo, d.Ü.) gegen den „teuren Bus“ und für eine „freie städtische Mobilität“ protestierten, die über den von den sozialdemokratischen Reformern jeder Epoche so geliebten „Anspruch des guten Schülers“ hinausgehen sollte. Kurz gesagt, wir lernten, soziale Untersuchungen aus unserem autonomen Antagonismus heraus durchzuführen, der nicht mehr der Zentralität der Fabrik untergeordnet war. Wir verstanden diesen kollektiven Protagonismus als die Praxis der Umkehrung des gesellschaftlichen Arbeiters, dessen Konzeption nichts mehr mit der offiziellen, vom PCI-Arbeitertum hegemonisierten Arbeiterbewegung zu tun hatte. Damit wurde eine deutliche Zäsur vollzogen. In der Abwesenheit der Erinnerung entfaltete sich die subjektive Autonomie in ihrer ganzen Fülle: Die Kontinuität zur „Sonne der Zukunft“ war gebrochen, der Kommunismus war „jetzt und sofort!”
Ein entscheidender Beitrag zur Neuinterpretation unserer Subjektivierung war, dass wir uns auf unsere eigene kleine Art und Weise den Werkzeugkasten des Operaismo angeeignet hatten, dessen Gebrauch wir dank Toni Negri (einem sehr wichtigen theoretisch-praktischen Bezugspunkt) gelernt hatten. Ich erinnere mich daran, wie wichtig die Verwendung des lessico marxiano für die Bewegung von Palermo geworden war, und zwar gerade durch die Unterscheidung, die die Operaisten von der klassischen Verwendung des Begriffs „Marxismus“ machten. Ich erinnere mich, dass ich von der Verwendung des Begriffs „Marxismus“ sehr überrascht war: Ich erkannte sofort, dass ich auf einen schwierigen, aber anregenden Forschungsweg gestoßen war, der für die Rekonstruktion einer politischen Praxis von grundlegender Bedeutung war; und vor allem fand ich den methodologischen Schlüssel in dem, was Negri als „Verlagerungsprozess“ definierte, der das Subjekt aus der hegelianischen Dialektik herauslöste, die sich in den dogmatischen Marxismus eingeschlichen hatte. Dieses theoretische Instrument erklärte im Wesentlichen die Dynamik des Operaismus: Zunächst stellte es alle Gewissheiten des Marxismus in Frage, die sich um die Figur des Facharbeiters herum entwickelt hatten, dann entdeckte es die historische Konkretisierung der Klassenzusammensetzung des antagonistischen Subjekts auf der Grundlage der Arbeitermassen, um die Konfliktebene mit der Entdeckung der Autonomie in der neuen Zusammensetzung des gesellschaftlichen Arbeiters erneut zu verschieben.
Nach der langen Zeit der geschichtlichen Determinierung des gesellschaftlichen Arbeiters hatte der soziale Konflikt innerhalb von etwas mehr als zwei Jahrzehnten mit beeindruckender Geschwindigkeit die antagonistische Subjektivierung in den Klassenbeziehungen innerhalb der Produktion verändert. So wurden wir als gesellschaftliche Arbeiter zum Gegenstand der revolutionären Forschung, indem wir den Horizont für die Vielfältigkeit der immateriellen Arbeit öffneten. Andererseits aber, da die Proletarisierung der Gesellschaft zu einer unaufhaltsamen Tatsache geworden war, wurden von da an nach und nach alle lebenswichtigen Räume besetzt, so dass kein möglicher Zwischenraum unerforscht blieb, in dem die kapitalistische Akkumulation die Biomacht als Inbegriff ihrer absoluten Herrschaft ausübte.
Mit anderen Worten, die Figur von Toni Negri war ein echter Klebstoff für die Autonomia operaia von Palermo, auch weil wir vor 1977 – vor allem in meiner Generation von Genossen – nicht so sehr an die Praxis der theoretischen Ausarbeitung gewöhnt waren: Von Zeit zu Zeit, zur Zeit der Sekten, wurden mit wenigen Ausnahmen lediglich Indoktrinationslesungen über die Klassiker des Marxismus organisiert, die einer Art Exerzitien über die Vulgata von Marx sehr ähnlich waren. Im Gegensatz zu diesem Dogmatismus war die Beschäftigung mit dem Operaismus und den Entwicklungen des negrianischen Denkens kein punktuelles Studium seiner Bücher oder derjenigen des ihm nahestehenden Entwicklungskollektivs (eine Brutstätte von Intellektuellen-Militanten, die mit ihm eine Menge Material produzierten, von denen viele unsere Bibliotheken bereicherten), sondern es war die Nutzung des Arbeitsstils und der „conricerca“ als Methode, um unser Untersuchungsfeld auf die Prozesse der Subjektivierung der Antagonisten auszudehnen, beginnend mit denen, die uns als Protagonisten im Konflikt der 70er Jahre gesehen hatten.
Im Grunde genommen haben wir die politische Dimension aufgegriffen, d.h. die Praxis der kollektiven Workshops, die von der Dynamik inspiriert war, die in den frühen 1960er Jahren von der operaistischen Schule der Quaderni Rossi verfolgt wurde, und die mit den verschiedenen Erfahrungen fortgesetzt wurde, bei denen Negri ein außerordentlicher Leitfaden war, der in der Lage war, die Vorwegnahme der sozialen Transformationen, die diese Workshops zu erkennen versuchten, meisterhaft darzustellen. Für uns von der Autonomia Operaia palermitana war der Blick auf Negris Weg eine meisterhafte Aufforderung, die von grundlegender Bedeutung für die Suche nach einem Platz im Subjektivierungsprozess war. In diesem Sinne scheint mir die Definition von Toni als „der gemeinsame Singular, der uns seit über einem halben Jahrhundert begleitet“, absolut geglückt.
Ich möchte klarstellen, dass ich diese Hommage mit der Betonung der kollektiven Dimension verfasst habe, ohne die ich nicht in der Lage gewesen wäre, mich im Laufe meiner politischen Schulung zu ernähren. Es ist ein Weg, der mich mit anderen GenossInnen verbindet, mit denen ich im Laufe der Zeit brüderliche Beziehungen und eine aktionsorientierte Gemeinsamkeit hatte, die sich über die Jahre in den intersektionalen Realitäten der Kampfbewegungen fortgesetzt hat. Es ist kein Zufall, dass wir uns mit einigen von ihnen noch heute in einem Workshop-Raum treffen, um uns weiterhin über die möglichen Entwicklungen der sozialen Konfliktualität im einundzwanzigsten Jahrhundert zu befragen. Und doch verpflichte ich mit meiner Erzählung keinen der anderen Protagonisten dieses kollektiven Subjekts von ’77.
Ich habe Toni persönlich kennen gelernt, als er nach Palermo kam, um Impero im Theater Agricantus vorzustellen, das noch nie so voll war wie an diesem Tag. Aber erst am Tag danach hatte ich einen direkten Kontakt, während einer Versammlung mit städtischen Bewegungen, die in der Buchhandlung Modusvivendi stattfand. In dieser Debatte fragte ich Toni, was er von der Notwendigkeit halte, eine neue organisatorische Phase in Bezug auf die gewerkschaftliche Konföderalität einzuleiten (ich war damals ein Gewerkschaftskader, der im öffentlichen Sektor tätig war). Kurz und bündig antwortete er, dass kein gewerkschaftlicher Konföderalismus, weder der alte noch der neue, geeignet wäre, die neue soziale Organisation der kognitiven Arbeit zu repräsentieren, die in den Mäandern der postindustriellen Gesellschaft verstreut ist und als Alternative zu den vertikalen Kategorien, die historisch in der klassischen Gewerkschaft konföderiert sind, einen echten „sozialen Unionismus“ vorwegnimmt, der das gesamte Potenzial des diffusen vertenzialismo erfassen würde.
Wir trafen uns dann am selben Abend zum Abendessen wieder. Bei ihm waren Judith Revel und Saro Romeo (ein Genosse aus Catania, mit dem wir brüderlich befreundet sind) und einige Genossen aus Palermo. Wir löcherten ihn mit Fragen zu den neuen Perspektiven, die das Empire-Konstrukt den Menschen eröffnete. In jenen Jahren gab es eine große Mobilisierung des so genannten „popolo viola“ als Antwort auf den Aufruf einiger berühmter Persönlichkeiten, allen voran Nanni Moretti, der die damalige, von der dalemiano Linken (link d. Ü.) geführte L’Ulivo Regierung aufforderte, sich aus der tödlichen Umarmung mit Berlusconi in der berühmten „Zweikammerregierung“ zu lösen. Ich hatte Zweifel an dieser Bewegung geäußert, da ich sie für eine rein institutionelle reformistische Praxis hielt. Ich war überrascht von Tonis Antwort, die stattdessen den großen Wunsch nach demokratischer Teilhabe von unten hervorhob, den diese Bewegung zum Ausdruck brachte, jenseits dessen, was die Medien daraus machten, indem er in dieser außergewöhnlichen Mobilisierung die Manifestation der Multitude sah. In gewissem Sinne fand ich sowohl in der Antwort auf die soziale gewerkschaftliche Bewegung als auch auf die große römische Demonstration „dei viola“ dieselben Überlegungen, die Toni zu den Kämpfen in Frankreich angestellt hat: Wie kann man zum Beispiel die Gilets Jaunes nicht in die Furche eines autonomen sozialen vertenzialismo außerhalb des klassischen Gewerkschaftsgedankens einsortieren?
Andererseits, wie kann man nicht die Möglichkeit der Multitude anerkennen, die Räume zu nutzen, die von den alten Paraphernalia der Linken des 20. Jahrhunderts angeboten werden, wie es zum Beispiel in den jüngsten Kämpfen gegen die Rentenreform der Regierung Macron, die von den traditionellen französischen Gewerkschaften organisiert wurden, der Fall war?
Jahre später hatte ich Gelegenheit, Toni bei zwei weiteren Gelegenheiten zu treffen: einmal in Palermo, im besetzten Garibaldi-Theater, und das andere Mal in Rom bei der Euronomade-Sommerschule. Das Erstaunliche war, dass er sich Jahre später an die Genossen aus Palermo erinnerte, mit denen er an jenem Abend in einer Trattoria zu Abend gegessen hatte, und uns eine absolute Freundlichkeit entgegenbrachte. Offensichtlich war jedoch die große Zuneigung, die er für alle seine Genossen empfand, vom Jüngsten bis zum Ältesten, die einen weiten Bogen zwischen den Generationen spannte. In Rom lernte ich mehrere andere Genossen kennen, mit denen wir immer noch Aktivitäten und Initiativen aufbauen, in dem Wissen, dass wir Teil einer größeren Gemeinschaft sind, die im Laufe von mehr als einem halben Jahrhundert mit ihren Diachronen ein revolutionäres Denken nachgezeichnet hat, das in der Lage ist, die historischen Veränderungen der Gesellschaft unter dem Gesichtspunkt der Subjektivierung zu erfassen und neu zu schreiben. Toni Negri war in dieser generationenübergreifenden Forschungsgemeinschaft sicherlich ein unersetzlicher Leuchtturm, ein wahrer schlechter Lehrer, dessen Gedanken wir lebendig halten werden, dessen Abwesenheit wir aber schmerzlich vermissen werden. Ciao Toni.
Übersetzt aus dem Italienischen von Bonustracks.