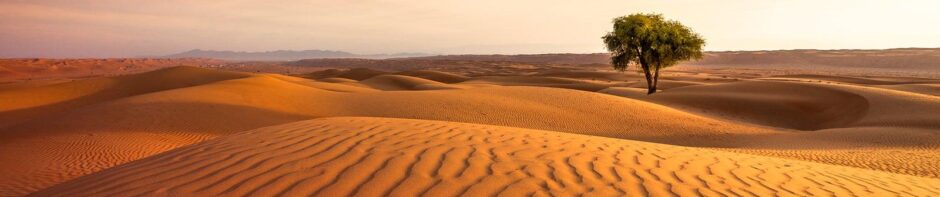Franco ‘Bifo’ Berardi
Marx hat nicht viel über Revolution gesprochen. Der Begriff der Revolution wird in seinen Werken nicht besonders ausgearbeitet. Ich wage zu behaupten, dass die Revolution für ihn nicht einmal ein Begriff ist: Sie ist ein Ereignis, das sich kaum strukturell fassen lässt.
Marx spricht von Revolution im Kommunistischen Manifest von 1848 und in Der Bürgerkrieg in Frankreich. Obwohl das Manifest bekannter ist, sind die anderen Schriften wegen des reifen Urteils über die Entwicklung der politischen Stärke der Arbeiterklasse von Bedeutung.
Obwohl seine früheren Werke weithin bekannt waren und sein Name von den Aufständischen der Kommune respektiert wurde, hatte Marx keinen direkten Einfluss auf die Ereignisse von 1871. Die Verschwörungstheorien von Blanqui und die anarchistischen Utopien von Proudhon waren in der politischen Bildung der Kommunarden weitaus stärker vertreten. Aber das ist für Marx von geringer Bedeutung: Er weiß, dass der Klassenkampf eher ein spontanes Werden als ein bewusst gesteuerter Prozess ist, und er weiß, dass die mögliche Emanzipation der menschlichen Epoche von den Fesseln der Lohnarbeit nicht nur von der strukturellen Dynamik des sozialen Konflikts abhängt, sondern auch vom unvorhersehbaren Aufkommen der Ereignisse.
Die Aufgabe, die sich Marx stellt, ist die der Interpretation der Ereignisse als Ausdruck einer immanenten Dynamik, die über das Bewusstsein der Akteure und die unbeständige Veränderlichkeit der Ereignisse hinausgeht. Trotz der entscheidenden Rolle, die Marx bei der Gründung und Leitung der Internationalen Arbeiterassoziation spielte, ist sein Profil nicht so sehr das eines politischen Führers, der die Bewegung lenkt und sich an die Menge der Aufständischen wendet. Vielmehr ist es das Profil eines Zeichendeuters, der die Entwicklung der immanenten Struktur mit der Entwicklung der sozialen Subjektivität verbindet.
Die Biographie von Marx und auch sein Werk kreisen um zwei unterschiedliche und manchmal sogar divergierende Aufgaben: die erste ist die Konstruktion eines theoretischen Gebäudes, die zweite die Teilnahme an den historischen Konflikten seiner Zeit, mit einem besonderen Interesse an den ersten Manifestationen des neuen politischen und sozialen Akteurs, der Arbeiterklasse. Die theoretischen Schriften, denen er seine intellektuelle Energie widmete, insbesondere das „Kapital“ und die „Grundrisse“, sowie die philosophischen Texte seiner Jugendzeit sind als Versuch zu verstehen, historische Tendenzen zu extrapolieren, die sich langfristig durchsetzen werden, während die sporadischen Texte, die im Zusammenhang mit Ereignissen geschrieben wurden, im Zusammenhang mit den intellektuellen und politischen Debatten seiner Zeit gelesen werden müssen.
Marx war nicht nur Philosoph, sondern auch Journalist, politischer Organisator und Polemiker, in gewisser Weise also ein Aktivist, wie seine elf Thesen über Feuerbach zeigt. Einige seiner Bücher sind Sammlungen von Artikeln (Lohnarbeit und Kapital wurde erstmals 1847 in der Neuen Rheinischen Zeitung veröffentlicht), andere sind Reden, die er vor einem Arbeiterpublikum gehalten hat (Lohn, Preis und Profit ist die Abschrift einer Rede, die er auf der Versammlung der Ersten Internationale im Juni 1865 hielt).
Der Text mit dem Titel Der Bürgerkrieg in Frankreich, der am 13. Juni 1871 in London veröffentlicht wurde, ist ein kurzes Dokument von fünfunddreißig Seiten, das aus der Sammlung von drei Reden besteht, die zu drei verschiedenen Zeitpunkten vor dem Generalrat der Internationale gehalten wurden. Die ursprünglich in englischer Sprache verfassten Texte sind von den Ereignissen in Paris zwischen 1870 und 1871 inspiriert: Ereignisse, die in der Erfahrung der Pariser Kommune gipfelten. Das Pamphlet enthält Überlegungen zum französisch-preußischen Krieg, zum Pariser Aufstand, zum Verrat der Regierung Thiers und viele andere Details. Aber die zentralen Seiten sind die, die der Erfahrung der Kommune gewidmet sind: eine Würdigung ihrer Neuartigkeit als autonome Manifestation der Arbeiterklasse als politisches Subjekt. In den Jahren nach der Erstveröffentlichung wurde das Pamphlet ins Französische, Deutsche, Russische, Italienische, Spanische, Niederländische, Flämische, Kroatische, Dänische und Polnische übersetzt und von verschiedenen Zeitungen neu aufgelegt.
Die absolute Neuartigkeit der Pariser Erfahrung, die weniger als hundert Tage dauerte und dennoch die politische Vorstellungskraft des nächsten Jahrhunderts tiefgreifend prägte, wird von Marx deutlich wahrgenommen. Obwohl sich ein großer Teil des Textes auf die politischen und militärischen Ereignisse konzentriert, interessiert sich Marx vor allem für den sozialen Inhalt der täglichen Aktivitäten der Kommunarden, insbesondere für die Verkündigung von Maßnahmen zur Verbesserung des kollektiven Lebens. Der Alltag der Kommune ist in der Tat durch die Verabschiedung von Dekreten gekennzeichnet, die den Grundstein für eine sozialistische Umgestaltung der Produktion und des kollektiven Lebens legen. Auf einer Seite des Textes fasst Marx die ersten Schritte der Kommune zusammen:
[…] ‚die Fahne der Kommune ist die Fahne der Weltrepublik‘. Am 1. April wird beschlossen, dass das höchste Gehalt eines Angestellten der Kommune, also auch das ihrer eigenen Mitglieder, 6.000 Francs nicht übersteigen soll. Am darauffolgenden Tag beschloss die Kommune die Trennung der Kirche vom Staat und die Aufhebung aller staatlichen Zahlungen für religiöse Zwecke sowie die Umwandlung des gesamten kirchlichen Vermögens in nationales Eigentum. Daraufhin wurde am 8. April beschlossen, alle religiösen Symbole, Bilder, Dogmen, Gebete, kurzum „alles, was in den Bereich des individuellen Gewissens gehört“, aus den Schulen zu verbannen, und diese Maßnahme wurde schrittweise umgesetzt. Am 5. April wird als Reaktion auf die täglich neuen Erschießungen von Kämpfern der Kommune, die von den Truppen von Versailles gefangen genommen wurden, ein Dekret über die Verhaftung von Geiseln erlassen, das jedoch nie umgesetzt wird. Am 6. wird die Guillotine mit Hilfe des 137. Bataillons der Nationalgarde herbeigeschafft und unter großem Jubel der Bevölkerung öffentlich verbrannt. Am 12. Mai beschloss die Kommune, die Siegessäule auf der Place Vendôme abzureißen, die nach dem Krieg von 1809 mit von Napoleon erbeuteten Kanonen gegossen und als Symbol für Chauvinismus und Völkerhass aufgestellt worden war.
Dies geschah am 16. Mai. Am 16. April ordnete die Kommune eine Statistik der von den Industriellen stillgelegten Fabriken und die Ausarbeitung von Plänen für den Betrieb dieser Fabriken durch die bisher dort beschäftigten Arbeiter an, die nun in Genossenschaften zusammengeschlossen werden sollten, sowie für die Organisation dieser Gesellschaften in einer großen Gewerkschaft. Am 20. wurde die Nachtarbeit der Bäcker abgeschafft, ebenso wie die Registrierung der Arbeiter, die seit dem Zweiten Kaiserreich ausschließlich durch von der Polizei beauftragte Personen, echte Ausbeuter der Arbeiter, durchgeführt wurde. Die Registrierung wurde den Rathäusern der zwanzig Pariser Bezirke anvertraut. Am 30. April ordnete sie die Abschaffung der Pfandhäuser an, die nichts anderes als eine private Ausbeutung der Arbeiter darstellten und im Widerspruch zum Recht der Arbeiter auf ihre Arbeitsmittel und Kredite standen. Am 5. Mai ordnete sie den Abriss der Sühnekapelle an, die als Wiedergutmachung für die Hinrichtung Ludwigs XVI. errichtet worden war.
Zum ersten Mal in der Geschichte rückt das Problem der Arbeit, insbesondere die Verkürzung der Arbeitszeit, in den Mittelpunkt der sich herausbildenden fortschrittlichen Kultur. Gleichzeitig wird in der Entwicklung des Klassenkampfes zum ersten Mal in der Geschichte bewusst das Problem des Staates angesprochen. Diese beiden Ebenen, die gesellschaftliche Umgestaltung des Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital und die sozialistische Umgestaltung des Staates, müssen unterschiedlich betrachtet werden. Die erste betrifft die strukturelle Dimension, die Marx in seinen theoretischen Texten untersucht hat, den grundlegenden Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital, den tendenziellen Fall der Profitrate und die mögliche Emanzipation des gesellschaftlichen Lebens von der Lohnarbeit, die Teil der Entwicklung des General Intellect ist. Die zweite Ebene betrifft die Ereignisdimension: Der individuelle Wille und der gesellschaftliche Konsens lassen sich nicht auf die strukturelle Dynamik reduzieren. Diese Dimension entzieht sich der strukturellen Analyse und öffnet die Tür zur unvorhersehbaren Sphäre der subjektiven Autonomie.
Zwanzig Jahre nach der Commune und neun Jahre nach dem Tod von Karl Marx schreibt Friedrich Engels in der Einleitung zur Neuauflage von Der Bürgerkrieg in Frankreich: „Am 28. Mai erlagen die letzten Kämpfer der Kommune der Übermacht auf dem Hügel von Belleville, und keine zwei Tage später, am 30. Mai, verlas Marx vor dem Generalrat die Schrift, in der die historische Bedeutung der Pariser Kommune so prägnant, kraftvoll und vor allem so wahrheitsgetreu zum Ausdruck kommt, wie es in der ganzen gewaltigen Literatur zu diesem Thema nicht möglich gewesen ist“. Über die Erfahrungen der Kommune sagt Engels, dass sie „von Anfang an erkennen musste, dass die Arbeiterklasse, nachdem sie einmal an die Macht gekommen war, die alte Staatsmaschinerie nicht fortgesetzt kontrollieren konnte, dass die Arbeiterklasse, um die soeben errungene Macht nicht wieder zu verlieren, andererseits die gesamte alte, bereits gegen sie eingesetzte Repressionsmaschinerie beseitigen und sich andererseits gegen ihre eigenen Abgeordneten und Angestellten absichern musste, indem sie diese ausnahmslos und jederzeit für widerrufbar erklärte“.
Engels analysierte das Problem, das Lenin später auf Gedeih und Verderb zu lösen versuchte: das Problem der Beziehung zwischen Struktur und Ereignis, zwischen der dem allgemeinen Produktionsprozess eingeschriebenen Dynamik (die zur Verkürzung der Arbeitszeit und zur Emanzipation der Gesellschaft von der Lohnarbeit führte) und den unvorhersehbaren Wendungen der sozialen Subjektivität und des politischen Willens. Lenin betonte das unbestimmte Wirken des politischen Willens, und Gramsci begrüßte in einem am 24. November 1917 in der sozialistischen Zeitung „Avanti“ veröffentlichten Artikel die bolschewistische Revolution als eine Revolution gegen das Kapital im doppelten Sinne des Wortes. Ein Ereignis, das die von Marx konzipierte strukturelle Kette durchbricht. Das Ereignis der Russischen Revolution ist ebenso wie das Ereignis der Pariser Kommune nicht vorhersehbar, da es sich nicht um eine notwendige Entwicklung der dem Produktionsprozess eingeschriebenen strukturellen Dynamik handelt. Darüber hinaus will Gramsci sagen, dass die Russische Revolution als ein Verstoß gegen oder Widerlegung der Überzeugung von Marx angesehen werden kann, dass sich die sozialistische Revolution zuerst in den fortgeschrittensten Industrieländern entwickeln muss. In ähnlicher Weise ist die Commune nicht die Manifestation einer impliziten Tendenz, sondern ein unvorhersehbares Ereignis. Ereignis und Struktur können nicht im Sinne einer notwendigen gegenseitigen Implikation beschrieben werden. Die Struktur impliziert nicht notwendigerweise jedes Ereignis.
Franz Mehring zufolge brachte die Pariser Polizei im Frühjahr 1871 einen Bericht in Umlauf, in dem Marx seine Ablehnung gegenüber den Kommunarden zum Ausdruck brachte, insbesondere mit der Begründung, dass diese sich mehr auf politische als auf soziale Fragen konzentrierten. Kurz darauf reagierte Marx mit einem in der „Times“ veröffentlichten Artikel, in dem er den Polizeibericht als unverschämte Erfindung bezeichnete, die noch dazu eine Art Fake News sei. Als ethisch motivierter Mensch fühlte sich Marx als politischer Kämpfer voll und ganz der Unterstützung der Pariser Commune verpflichtet. Dennoch ist dieser Polizeibericht nicht völlig bedeutungslos. Ein intelligenter flic, der die theoretischen Texte von Karl Marx gelesen hätte, hätte durchaus vermuten können, dass der strenge Philosoph mit der politischen Symbolik der Kommunarden nicht einverstanden war und daher das Ereignis im Namen der strukturellen Vorhersagen, die seine Theorie impliziert, ablehnen konnte. Marx war jedoch weder ein Determinist noch ein griesgrämiger Doktrinär. Er erwartete keineswegs, dass das historische Ereignis mit der Strukturanalyse und ihren Vorhersagen übereinstimmen würde. Er war kein dogmatischer Gläubiger der historischen Notwendigkeit.
In ihrem Buch Communal Luxury stellt Kristin Ross fest, dass für Marx „das Wichtigste an der Commune nicht die zu verwirklichenden Ideale waren, sondern die Existenz dieses Experiments. Er betonte, dass die Aufständischen nicht über ein abstraktes Modell der zukünftigen Gesellschaft verfügten. Die Kommune war ein funktionierendes Laboratorium der politischen Erfindung […] in den Tagen der Kommune wollte Paris nicht die Hauptstadt Frankreichs sein, sondern ein autonomes Kollektiv in einer universellen Föderation der Völker“ [1]. In der Tat schreibt Marx:
Die Arbeiterklasse hat keine Wunder von der Commune erwartet. Sie hat keine vorgefertigten Utopien, die sie par dècret du peuple einführen könnte. Sie weiß, dass sie, um ihre eigene Emanzipation und damit jene höhere Form zu verwirklichen, zu der die heutige Gesellschaft durch ihre eigenen ökonomischen Faktoren unwiderstehlich tendiert, durch lange Kämpfe, durch eine Reihe von historischen Prozessen gehen muss, die die Umstände und die Menschen verändern werden. Die Arbeiterklasse hat nicht die Aufgabe, Ideale zu verwirklichen, sondern die Elemente der neuen Gesellschaft zu befreien, die von der alten und verfallenden bürgerlichen Gesellschaft unterdrückt werden.
In La Commune, Histoires et souvenirs [2] erzählt Louise Michel: „Eines Nachts, ich weiß nicht, wie es dazu kam, waren wir beide allein im Stellungsgraben vor dem Bahnhof: der ehemalige päpstliche Zuavo und ich, mit zwei geladenen Gewehren […] wir hatten unglaubliches Glück, dass der Bahnhof in dieser Nacht nicht angegriffen wurde […] während wir im Dienst waren und im Graben hin und her liefen, sagte er plötzlich zu mir: Welche Wirkung hat das Leben, das wir führen, auf dich? Und ich sagte zu ihm: Nun, die Wirkung besteht darin, dass wir sehen, dass vor uns ein Hafen liegt, den wir erreichen müssen. Und er antwortete mir: Die Wirkung, die ich spüre, ist die von jemandem, der ein illustriertes Abenteuerbuch liest. Wir gingen weiter schweigend im Graben hin und her“.
In dieser Szene, in diesem kurzen Gespräch können wir eine Metapher für die zukünftige revolutionäre Bewegung lesen, die im 20. Jahrhundert dazu bestimmt war, die Welt zu erschüttern. Ein leidenschaftlicher Intellektueller geht mit einem Soldaten aus dem Vatikan spazieren, der die Reihen der pro-französischen Koalition verlassen hat, um sich der Garde des seltsamen, etwas weltfremden Experiments der Arbeiterkommune anzuschließen. Er fragt sie: Was ist der Sinn der Erfahrung, die wir machen? Und sie antwortet wie eine Intellektuelle, wie eine politische Kämpferin: Wir sind auf einem Schiff und versuchen, den Hafen zu erreichen, ein neues Land, eine neue Welt zu entdecken und aufzubauen. Der Soldat Zuavo schüttelt den Kopf, lächelt und antwortet dann ganz offen: Nein, nein, für mich ist das wie die Lektüre von Bilderbüchern, die unvorstellbare Panoramen und spannende Fluchtwege beschreiben. In diesem nächtlichen Dialog lassen sich die Keime zweier unterschiedlicher Ansätze zur Geschichte finden, die das 20. Jahrhundert durchzogen. Was ist Geschichte, das Bemühen, einen Hafen zu erreichen, oder ein bezaubernder Reiseweg, auf dem wir etwas entdecken, das wir nicht erwartet haben?
[1] K. Ross, Communal Luxury, Verso, London 2015, S. 11.
[2] La Decouverte, Paris 2005, S. 170, erstmals veröffentlicht 1898.
Anmerkung deutsche Übersetzung: Der Text ‘Der Bürgerkrieg in Frankreich‘ von Karl Marx findet u.a. hier:
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1871/05/30-burfr.htm
Erschienen am 16. März 2021 auf Machina, ins Deutsche übersetzt von Bonustracks.