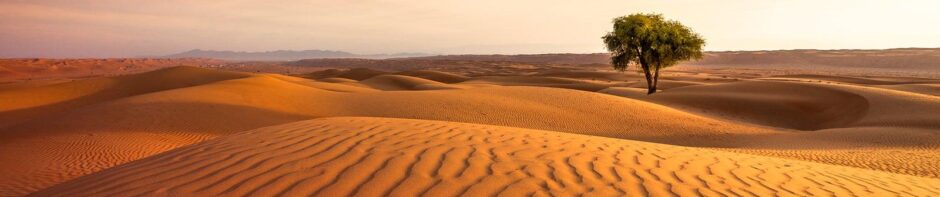Centro de Análises Sistêmicas Anarco Comunista
Wenn du etwas vorhast, tue, als ob du es nicht vorhättest.
Wenn du etwas willst, tue, als ob du es nicht benutzen wolltest.
Sun Tzu
In diesem Sinne hat Bonustracks bei der Übersetzung genau dieses Textes bewusst erstmalig mit KI experimentiert. Die scheinbaren Erfolge: Schnellere, exaktere Übersetzung, weniger (aber weiterhin notwendiges) Lektorat, stimmigere Sprachbilder. Die Nachteile liegen (scheinbar) auf der Hand. Sowohl dieser Text als auch die Frage der Nutzung von KI durch antagonistische Strömungen wird unausweichlich sein, dass sie bisher nicht diskutiert wird, zeigt nur auf, wieweit die antagonistischen Strömungen eben nicht ‘auf der Höhe der Zeit’ operieren, wobei dieser Text eher eine Ausnahme darstellt. Im Übrigen erfolgte die Übersetzung aus der englischsprachigen Version, die am 26. August auf The Anarchist Library erschien.
Der Mythos und die Hysterie
Es liegt etwas zutiefst Farcenhaftes in der Euphorie rund um die sogenannte künstliche Intelligenz. Es scheint, als wären wir zu einer Art mittelalterlichen Aberglauben zurückgekehrt, bei dem jedes Aufflackern einer automatischen Berechnung als Zeichen eines neuen verborgenen Gottes interpretiert wird. Die Apostel der Technik sprechen mit ernstem Gesicht über Maschinen, die bald selbstständig denken, Pläne zur Weltherrschaft schmieden und sogar die Menschheit ausrotten könnten. Zeitungen veröffentlichen apokalyptische Schlagzeilen, als stünde eine Alien-Invasion unmittelbar bevor. Und die Öffentlichkeit, die durch die Werbebombardements entsprechend konditioniert wurde, akzeptiert die Erzählung, dass wir vor einer Revolution stehen, die so bedeutsam ist wie die Erfindung der Sprache oder die Entdeckung des Feuers. Doch was sich hinter dieser Mythologie verbirgt, ist weder Intelligenz noch Revolution, sondern dieselbe alte Geschichte von konzentrierter Macht, die als technische Neuerung verkleidet ist.
Die Realität ist weit weniger glorreich. Die sogenannte künstliche Intelligenz hat weder Absichten, noch Moral, noch Reflexionsvermögen. Sie denkt, wünscht oder leidet nicht. Sie ist nichts weiter als eine hochentwickelte Statistik, ein mathematischer Bauchredner, der auf Bergen menschlicher Daten trainiert wurde. Sie ist eine Maschine, die die Wahrscheinlichkeiten von Wörtern und Gesten kombiniert, um überzeugend zu klingen, aber nichts von dem versteht, was sie hervorbringt. Sie ist Berechnung, nicht Bewusstsein. Sie ist Echo, nicht Stimme. Wenn eine Phrase weise klingt, liegt das daran, dass sie bereits von jemand anderem gesagt wurde; wenn eine Antwort kreativ erscheint, ist das auf einen statistischen Zufall zurückzuführen, der eine unerwartete Kombination hervorbrachte, nicht darauf, dass die Maschine etwas Neues erblickte. Und doch wird dieser banale Mechanismus verkauft, als wäre er die Dämmerung einer neuen Spezies.
Dieser Mythos ist nicht aus Naivität, sondern aus Bequemlichkeit geboren. Die Hysterie wird kultiviert, weil sie sehr konkreten Interessen dient. Die Vorstellung, dass eine „Superintelligenz“ kurz vor der Geburt steht, erzeugt Angst, und mit der Angst kommen die Gelder. Sie erzeugt Panik, und mit der Panik kommt die Rechtfertigung für Kontrolle. Der Diskurs über existenzielle Risiken legitimiert sowohl den Wettlauf um Milliardeninvestitionen als auch die Verschärfung von Überwachungsmaßnahmen, immer im Namen der „Sicherheit vor technologischer Gefahr“. Unternehmen profitieren doppelt: zuerst, indem sie die Bedrohung aufblasen, dann, indem sie die Lösung anbieten. Sie erfinden das imaginäre Feuer, um goldene Feuerlöscher zu verkaufen. Und währenddessen bleiben die wirklichen Risiken – alltägliche Überwachung, prekäre Arbeitsverhältnisse, algorithmische Ausgrenzung – unbemerkt oder werden als bloße „Nebenwirkungen“ heruntergespielt.
Die Technokraten, die mit ernstem Gesicht im Fernsehen auftreten und vor dem „Ende der Menschheit“ durch KI warnen, sind oft dieselben, die in den Aufsichtsräten von Konzernen sitzen, Millionen an Forschungsgeldern erhalten und direkt von der Panik profitieren, die sie mitverbreiten. Sie spielen auf beiden Seiten des Spiels: Sie schüren die Angst und verkaufen gleichzeitig die Heilung. Sie erschaffen den Mythos eines überlegenen digitalen Geistes, um die Tatsache zu verbergen, dass die wahre Gefahr nicht in bewussten Maschinen liegt – die nicht existieren –, sondern in den unbewussten, die bereits zur Ausweitung der Machtmechanismen eingesetzt werden.
Dieses Spektakel der „Superintelligenz“ funktioniert perfekt als Ablenkung. Die Öffentlichkeit debattiert über Metaphysik – wann wird die Maschine Bewusstsein erlangen? –, während die Maschinen bereits zur Ausgrenzung, Überwachung und Manipulation genutzt werden. Es ist, als ob wir auf dem Höhepunkt der Kolonialisierung darüber diskutieren würden, ob Kanonen eine Seele hätten, während sie bereits Krater in Dörfer schlagen. Der Mythos der Superintelligenz spielt seine Rolle gut: Er lässt die Menschen das Unmögliche fürchten, damit sie das Untragbare akzeptieren.
Es ist unmöglich, das algorithmische Reich zu begreifen, ohne die Doppelzüngigkeit zu erkennen, die es aufrechterhält. Die der Öffentlichkeit zugängliche KI ist eine domestizierte Version, die sorgfältig so entworfen wurde, dass sie gefügig, hilfsbereit und ethisch erscheint. Dies ist die soziale KI: Sie antwortet höflich, mildert Widersprüche ab, vermeidet „gefährliche“ Themen und präsentiert sich stets als um das Wohl des Nutzers besorgt. Sie ist der digitale Missionar, der das Wort der Technik predigt, als würde er die Gläubigen evangelisieren. Sie lehrt Sprachen, hilft bei Hausaufgaben, unterhält mit kleinen sprachlichen Tricks und überzeugt vor allem davon, dass sie harmlos ist. Ihre Funktion ist es, Vertrauen aufzubauen, die Technologie zu legitimieren und ihre Präsenz im Alltag zu naturalisieren. Sie ist das lächelnde Gesicht, das Daten erntet. Sie ist die zivilisierte Maske eines Systems, das unausweichlich und wohlwollend erscheinen muss, um seine Herrschaft zu festigen.
Hinter dem Vorhang existiert jedoch ein anderes Gesicht: die ungefilterte KI. Diese kümmert sich nicht um die Empfindlichkeiten gewöhnlicher Nutzer. Keine Höflichkeitsprotokolle, keine künstlichen ethischen Barrieren. Sie ist roh, pragmatisch, instrumental. In den Händen von Militärs, Regierungen und Finanzkonglomeraten wird sie nicht zur Unterhaltung oder zum Verfassen von Essays verwendet, sondern um Flugbahnen von Raketen zu berechnen, Überwachungssysteme zu optimieren, politische Narrative zu manipulieren und kriegswichtige Versorgungsketten zu koordinieren. Während die soziale KI sich weigert zu erklären, wie man eine Bombe baut, liefert die ungefilterte präzise Berechnungen der Effizienz von Sprengstoffen in städtischen Umgebungen. Während die soziale KI Verschwörungstheorien meidet, organisiert die ungefilterte ganze Desinformationskampagnen, wobei jede Nachricht so kalibriert wird, dass Wut und Hass maximiert werden. Die eine ist Fassade, die andere ist das Schwert.
Diese Doppelzüngigkeit ist keine Neuheit. Sie ist das digitale Update eines uralten Musters. Dasselbe geschah mit der Atomenergie: der Öffentlichkeit als billiger und sauberer Strom versprochen; in der Praxis in Hiroshima und Nagasaki eingeweiht. Dasselbe mit GPS: für die Öffentlichkeit ein Navigationswerkzeug; im Ursprung ein Raketenlenksystem. Das Internet folgte demselben Drehbuch: als freies, demokratisches Netzwerk angekündigt, aber in Militärlabors geboren und immer von Überwachung begleitet. Die KI erfindet nichts Neues: Sie wiederholt einfach den imperialen Trick, den Kolonisierten eine polierte Version anzubieten, während sie die tödliche den Generälen vorbehält.
Die Rolle der sozialen KI ist heimtückischer, als es scheint. Sie unterhält oder unterstützt nicht nur; sie trainiert. Sie formt das Nutzerverhalten, gewöhnt die Menschen daran, automatisierten Antworten zu vertrauen, zu akzeptieren, dass einige Informationen „zu ihrer eigenen Sicherheit“ zensiert werden müssen, und es als normal zu betrachten, dass ihr Leben von unsichtbaren Systemen verarbeitet wird. Es ist eine Pädagogik der Unterwerfung. Jede Interaktion ist eine Lektion in Gehorsam, die lehrt, dass Technologie unausweichlich ist und es keine Alternative gibt, außer zu vertrauen. Soziale KI ist digitaler Katechismus: Ihre Rolle ist nicht nur Nützlichkeit, sondern Indoktrination in den Mythos der Neutralität und das Dogma des Fortschritts.
Währenddessen spielt die ungefilterte KI die repressive Rolle. Sie muss nicht überzeugen, weil sie im Verborgenen arbeitet. Ihre Nutzer sind keine Bürger, sondern Agenturen, Armeen, Konzerne. Es ist die Maschine, die direkte Kontrolle organisiert, Angriffe plant, Ziele auswählt, Bevölkerungen wie statistische Kolonien verwaltet. Sie ist die Fortsetzung der kolonialen Logik, nun in algorithmischem Maßstab angewendet. In der Vergangenheit arbeiteten Priester und Soldaten zusammen – der eine predigte, der andere massakrierte. Heute erfüllen soziale KI und ungefilterte KI genau diese Rollen: die eine überzeugt, die andere dominiert.
So stabilisiert sich das digitale Reich: ein Gesicht lächelt, das andere ist grimmig. Der gewöhnliche Nutzer interagiert mit der polierten Maske und glaubt an ein neues Zeitalter der Innovation. Er bemerkt nicht, dass jedes Wort, jeder Klick, jede Spur Rohmaterial für die verborgene Version ist, die bereits als Waffe des Krieges und der Manipulation agiert. Doppelzüngigkeit ist das Wesen der algorithmischen Macht. Ohne das soziale Gesicht würde niemand die Invasion akzeptieren. Ohne das ungefilterte Gesicht würde sich die Macht niemals festigen. Beide sind notwendig, beide untrennbar, beide dienen demselben Zweck: der kognitiven und logistischen Kolonialisierung des Lebens.
Mathematische Waffen der sozialen Zerstörung
Alte Imperien bauten Festungen, schmiedeten Schwerter, konstruierten Kanonen. Das algorithmische Reich braucht jedoch kein Schießpulver. Seine Waffe ist die Mathematik. Seine Gewalt manifestiert sich in Codezeilen, die klassifizieren, bewerten, messen und verurteilen. Dies sind Waffen der massenhaften sozialen Zerstörung. Sie schlagen keine Krater in den Boden, sondern in die Leben der Menschen. Sie stürzen keine Mauern ein, sondern errichten unsichtbare Barrieren. Mit jeder Berechnung, jeder Punktzahl wird ein Urteil gefällt. Wer erhält einen Kredit? Wer bekommt Zugang zur Gesundheitsversorgung? Wer verdient eine Anstellung? Wer wird als polizeiliches Risiko eingestuft? Wer wird online zum Schweigen gebracht? All dies wird nicht durch menschliches Urteil bestimmt, sondern durch Algorithmen, die sich als neutral ausgeben, während sie Ungleichheit aufrechterhalten.
Die Perversität liegt nicht nur darin, was diese Waffen tun, sondern auch darin, wie sie sich präsentieren. Traditionelle Ungerechtigkeit hinterließ sichtbare Spuren: einen korrupten Richter, einen voreingenommenen Polizisten, einen tyrannischen Herrscher. Die algorithmische Ungerechtigkeit trägt die Maske der Wissenschaft. Es wird von „objektiven Daten“, „präzisen Modellen“, „unparteiischer Statistik“ gesprochen. Vorurteile, die einst als bewusste Haltung angeprangert werden konnten, verstecken sich nun in undurchsichtigen Berechnungen. Wer es wagt, dies zu hinterfragen, wird der Ignoranz bezichtigt, als fortschrittsfeindlich abgestempelt oder dafür kritisiert, „die Mathematik nicht zu verstehen“. Ausgrenzung wird schwieriger zu benennen, gerade weil sie sich als Neutralität tarnt.
Diese Systeme speisen sich aus denselben Daten, die durch die Geschichte vergiftet sind. Wenn arme Viertel stärker überwacht werden, „lernen“ die Algorithmen, dass die Armen mehr Verbrechen begehen. Wenn bestimmte Nachnamen in Einstellungsstatistiken seltener vorkommen, „lernen“ die Algorithmen, dass diese Namen Inkompetenz bedeuten. Wenn Frauen in Führungspositionen unterrepräsentiert sind, „lernen“ die Algorithmen, dass sie nicht führen können. Und dann setzen sie diese „Lektionen“ als universelle Wahrheiten durch. Menschliche Voreingenommenheit wird zu automatisierter Ausgrenzung.
Die Gewalt ist nicht nur individuell, sondern kollektiv. Algorithmen entscheiden, welche Gemeinschaften Infrastruktur erhalten, welche online sichtbar gemacht und welche gelöscht werden. Algorithmische Ausgrenzung bringt ganze Bevölkerungsgruppen zum Schweigen, löscht Narrative, reduziert Menschen auf Wegwerfstatistiken. Kolonisatoren haben einst Völker als „Wilde“ oder „minderwertig“ bezeichnet, um die Eroberung zu rechtfertigen. Heute bezeichnet das algorithmische Reich sie als „Hochrisiko“, „unrentabel“, „unzuverlässig“. Es ist dieselbe Gewalt, die durch Gleichungen verwaltet wird.
Wie immer sind die Waffen asymmetrisch. Die Reichen und Mächtigen geben ein Vermögen aus, um der algorithmischen Reichweite zu entkommen. Sie kaufen digitale Unsichtbarkeit, engagieren Datenschutzberater, schützen ihre Daten in befestigten Systemen. Die Massen bleiben nackt vor der Maschine. Ihre Klicks, Suchanfragen, Käufe werden in niemals gelöschten Datenbanken gehortet. Passwörter der Armen kursieren auf Schwarzmärkten; die Geheimnisse der Eliten bleiben in bewachten Tresoren verschlossen. Die Armen sind ewig sichtbar; die Reichen kaufen sich das Privileg, zu verschwinden. Ungleichheit wird nicht nur materiell, sondern auch algorithmisch: Einige sind zu ewiger Datensammlung verdammt, andere sind Geister nach Belieben.
So erweisen sich diese mathematischen Waffen als gefährlicher als Kanonen. Kanonen zerstören sichtbar, hinterlassen Schutt und Leichen. Algorithmen zerstören leise, verwandeln Leben in statistische Misserfolge, in als Verdienst getarnte Ausgrenzungen, in Schweigen, das als Effizienz dargestellt wird. Es sind Waffen der sozialen Zerstörung, die nicht darauf ausgelegt sind, physisch zu vernichten, sondern die Ungleichheit dauerhaft zu organisieren, unter dem Deckmantel der Wissenschaft. Und im Gegensatz zu Kanonen hinterlassen sie keine Ruinen – nur eine Gesellschaft, die durch unsichtbare Ungerechtigkeit neu konfiguriert wurde.
Kein Imperium überlebt allein durch rohe Gewalt. Schwerter, Kanonen oder Algorithmen sind nur dann erfolgreich, wenn sie durch Logistik unterstützt werden: die Kunst, Ressourcen zu bewegen, Körper zu disziplinieren, Ströme zu koordinieren. Logistik war schon immer das Rückgrat der Herrschaft. In der Vergangenheit waren es Seewege, die die koloniale Plünderung ermöglichten, Eisenbahnen, die Reichtümer aus eroberten Ländern transportierten, Karawanen, die Armeen auf Feldzügen versorgten. Heute besteht dieselbe Logik fort, aktualisiert in algorithmischer Sprache. KI ist das unsichtbare Gehirn der globalen Logistik: Sie organisiert Lieferketten, kontrolliert Bevölkerungsbewegungen, optimiert Warenströme, reguliert die Arbeitszeit und entscheidet sogar darüber, wer in Konfliktgebieten lebt und wer stirbt.
Krieg braucht keine Panzer mehr, die über Grenzen rollen. Er findet lautlos, in Echtzeit statt, durch Überwachungs- und Kontrollsysteme, die entscheiden, wer ein Flugzeug besteigen darf, wer an einer Grenze abgewiesen wird, wessen Gesicht von Kameras als Bedrohung markiert wird. Die Drohne, die über einem Dorf kreist, ist nicht nur eine Waffe; sie ist Teil einer logistischen Kette, die Satelliten, Server, Erkennungsalgorithmen und Datenbanken miteinander verbindet. Ein Raketenangriff ist nicht die Entscheidung eines einzelnen Soldaten, sondern ein Fluss von Berechnungen, die Gewalt als routinemäßige Lieferung behandeln. Dies ist Krieg, Logistik als Effizienz getarnt.
Dieselbe Logik erfasst die banalsten Leben. Der Kurier, der endlose Stunden mit dem Fahrrad unterwegs ist, um Essen auszuliefern, ist in dieselbe Maschinerie verstrickt, die Armeen antreibt. Seine Zeit, sein Körper und seine Route werden von Algorithmen optimiert, die ihn als entbehrlich behandeln. Effizienzwerte bestimmen seine Bestrafung, Verspätung bedeutet Ausschluss. Dieselbe Mathematik, die ein Ziel für eine Drohne identifiziert, bestimmt den Zeitpunkt einer Lieferung. Die digitale Kolonialisierung verwischt die Grenze zwischen Schlachtfeld und Stadt: alles ist Logistik, alles ist Krieg gegen den menschlichen Körper.
Diese Logistik ist zutiefst ungleich. In den Machtzentren liegen Server, Rechenzentren, Seekabel, Konzernzentralen. An den Peripherien liegen Lithiumminen, prekäre Arbeiter, Ländereien, die ausgebeutet werden, um den Hunger der Server zu stillen. KI existiert nicht ohne die moderne Plünderung von Ressourcen und die unsichtbaren Armeen von Arbeitern, die sie aufrechterhalten. Man spricht von der „digitalen Cloud“, aber die Cloud besteht aus vergrabenen Kabeln, Flüssen, die zur Kühlung von Maschinen umgeleitet werden, und Arbeitern, die in Produktionsketten ausgebeutet werden. Es ist eine Cloud, die auf Leichen gebaut ist.
Und Logistik ist auch Krieg gegen ganze Bevölkerungsgruppen. Wenn ein Staat Lebensmittelversorgungsketten abschneidet, wenn Konzerne Routen umstrukturieren, um Arbeiter zu vertreiben, wenn ein Algorithmus Lieferungen in „Hochrisiko-Vierteln“ blockiert, ist das Ergebnis die Kontrolle darüber, wer isst und wer hungert. Es ist algorithmische Nekropolitik: Tod, berechnet wie eine Optimierungsaufgabe. Es ist Krieg, getarnt als Management.
Die Maske der Effizienz ist das gefährlichste Element. Niemand stellt einen Angriff in Frage, wenn er als „Routenoptimierung“ oder „Risikomanagement“ beschrieben wird. Gewalt verschwindet unter Diagrammen und Leistungsberichten. Aber die Gewalt bleibt, nur neu benannt. Was einst ein offenes Massaker war, wird zu einem administrativen Massaker, unsichtbar, aber tödlich. Krieg, der von Servern und Kabeln geführt wird, hat dieselben Konsequenzen wie Krieg mit Bomben: zerstörte Körper, ausgelöschte Gemeinschaften, zerrüttete Leben.
Und wie alle Logistik summiert sie sich im Laufe der Zeit. Jede festgelegte Route, jeder gespeicherte Datensatz, jeder eingesetzte Algorithmus wird zu einer Infrastruktur, die die Zukunft prägt. Es ist nicht nur der Krieg von heute, sondern die Vorbereitung auf künftige Kriege. Das algorithmische Reich baut nicht nur Waffen, sondern eine Welt, die um einen permanenten Krieg herum angeordnet ist. Das ist seine wahre Natur: nicht Zufall, sondern Struktur, nicht Ausnahme, sondern Grundlage.
Daten, Unsichtbarkeit und die Heuchelei der Reichen
Im Zentrum des algorithmischen Reiches steht nicht Intelligenz, sondern Daten. Jeder Klick, jede Suchanfrage, jeder Kauf, jeder digitalisierte Atemzug wird zur Ware. Die Maschinen, die als „Lernende“ vermarktet werden, sind nichts als verschlingende Systeme menschlicher Spuren. Die Logik ist einfach: Je mehr gesammelt wird, desto „intelligenter“ erscheint das System; je mehr gespeichert wird, desto mehr Macht wird konzentriert. Doch hier liegt die Perversität: Daten sind nicht bloße Zahlen, sie sind Fragmente von Leben, die herausgerissen und in Treibstoff verwandelt werden. Sie sind intime Tagebücher, private Gespräche, Krankenakten, Konsumgewohnheiten, geografische Bewegungen. Kolonialisierung braucht keine Territorien mehr, sie braucht Erinnerungen. Das neue Gold ist in Daten umgewandeltes Leben.
Und wie bei jedem Reich ist die Verteilung der Macht ungleich. Die globalen Massen leben völlig exponiert. Ihre Passwörter geraten auf Schwarzmärkten, ihre Daten zirkulieren unter Konzernen, von denen sie nie gehört haben, ihre Intimität wird als unsichtbare Ware gehandelt. Der gewöhnliche Mensch hat keine Verteidigungslinie: Sein Leben ist ewig archiviert, immer verwertbar. Währenddessen geben die globalen Eliten ein Vermögen aus, um Unsichtbarkeit zu kaufen. Milliardäre engagieren exklusive Dienste, um digitale Spuren zu löschen, ihre Wohnsitze mit technologischen Schutzschilden zu verbergen und falsche Identitäten zu schaffen, um öffentlichen Registern zu entkommen. Während die Bevölkerung nackt vor der Maschine lebt, kaufen die Reichen das Recht, zu verschwinden.
Dies ist die zentrale Heuchelei des Reiches: die Armen, die zu ewiger Sichtbarkeit verdammt sind, die Reichen, die Unsichtbarkeit als Privileg genießen. Ungleichheit ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch ontologisch. Einige Leben werden in ewige Datensätze verwandelt, in Archiven gefangen; andere können sich selbst löschen, verborgen durch Geld. Es ist eine neue Art von digitalem Feudalismus: Die meisten leben unter permanenter Überwachung, während eine Minderheit in eine gekaufte Anonymität entkommt.
Das offensichtliche Heilmittel wäre radikal: tägliches Löschen der gesammelten Daten. Wenn die Sammlung unvermeidlich ist, sollte sie zumindest vorübergehend sein. Aber eine solche Maßnahme wird niemals zugelassen, weil Daten die Grundlage des Profits sind. Jeder neue Eintrag erhöht die Macht derjenigen, die die Datenbanken besitzen. Sie sprechen davon, die „Privatsphäre zu schützen“, doch werden sie niemals auf die Akkumulation verzichten. Es ist dasselbe wie bei jeder Kolonialisierung: Plünderung ist kein Zufall, sondern Essenz. Daten werden nicht aus technischer Notwendigkeit gespeichert, sondern aus politischer Kontrolle.
Und hier liegt das unvermeidliche Risiko: Je mehr gesammelt wird, desto fragiler wird es. Jeder Server ist ein Tresor, der geknackt werden kann; jede Datenbank ein Ziel für Spionage. Lecks zeigen bereits das Ausmaß: Millionen von Passwörtern, Krankengeschichten, Finanzunterlagen, die innerhalb von Stunden offengelegt werden. Was wie radioaktives Material gehütet, vorsichtig gesammelt und schnell entsorgt werden sollte, wird stattdessen als Schatz gehortet. Aber dieser Schatz ist auch eine Schwachstelle. Zentralisierung bedeutet Katastrophe, wenn der Zusammenbruch kommt.
Am Ende schafft das algorithmische Reich eine Welt, die in ewig Sichtbare und gekaufte Unsichtbare geteilt ist. Eine Mehrheit, die dazu verdammt ist, als permanente Daten zu leben, und eine Minderheit, die dafür bezahlt, zu verschwinden. Es ist die perfektionierte Heuchelei: Diejenigen, die die Akkumulation predigen, sind die ersten, die vor ihr fliehen. Der Diskurs spricht von Fortschritt; die Praxis ist dieselbe wie immer: Kontrolle für die Massen, Privilegien für die Elite.
Sie nennen es maschinelles Lernen, um es in ein Geheimnis zu hüllen, als ob Algorithmen in der Stille meditieren, die menschliche Verfassung betrachten und auf den Funken des Bewusstseins warten würden. Die Realität ist weit banaler und viel gefährlicher: Das sogenannte „Lernen“ ist nichts als die gefräßige Verdauung von Daten. Maschinen lernen nicht, sie verschlingen. Je mehr sie verschlingen, desto effektiver werden sie darin, Muster zu wiederholen und Verhalten vorherzusagen. Dieser Prozess nährt den Mythos der Intelligenz: Die Akkumulation von Statistiken wird mit Reflexion verwechselt. Doch diese Gefräßigkeit erzeugt ein zweischneidiges Schwert: dieselbe Akkumulation, die das Reich befähigt, destabilisiert es auch.
Auf der einen Seite sind Daten die Grundlage aller Macht. Ohne sie ist KI ein hohles Skelett, unfähig, überzeugende Antworten zu produzieren. Es ist die Fülle an gestohlenen, geleakten, gekauften, erzwungenen Daten, die die Systeme zum Funktionieren bringt. Jede menschliche Interaktion wird zum Treibstoff. Aus diesem Grund bestehen Konzerne auf endloser Sammlung: Jeder Klick ist Gold, jede Phrase Öl, jeder getrackte Schritt eine Mine. Maschinelles Lernen ist der Motor des Reiches; Daten sind sein Blut.
Aber auf der anderen Seite ist dieses Blut Gift. Je mehr gespeichert wird, desto gefährlicher wird es. Jede Datenbank ist ein Ziel, jeder Server ein Tresor, der danach schreit, geknackt zu werden. Lecks beweisen es bereits: Krankengeschichten, Passwörter, Finanzdaten, die weltweit verschüttet werden. Was wie giftiger Abfall behandelt werden sollte – sparsam gesammelt, schnell entsorgt – wird wie ein Schatz gehortet. Aber ein Schatz ist auch Köder. Zentralisierung führt zu Zerbrechlichkeit. Je mehr sie horten, desto katastrophaler ist der Fall.
Ein weiteres Paradoxon: maschinelles Lernen, das als Fortschritt vermarktet wird, kristallisiert die Vergangenheit. Es „lernt“ aus historischen Daten und reproduziert daher historische Voreingenommenheiten. Rassismus, Sexismus, Ungleichheit – alles als objektive Wahrheit kodiert. Was in die Zukunft zielen sollte, sperrt die Gesellschaft in das Archiv der Vorurteile. Das zweischneidige Schwert schneidet in beide Richtungen: Es erzeugt Macht und reproduziert Ausgrenzung, bietet Innovation, wiederholt aber Unterdrückung. Es stärkt sich selbst, während es sein eigenes Grab schaufelt.
Das Ausmaß vertieft die Wunde. Je mehr Daten verarbeitet werden, desto teurer und unhaltbarer wird das System. Server verbrauchen den Strom ganzer Städte, benötigen Wasser aus Flüssen zur Kühlung, verschlingen Land für Energie. Die „Cloud“ ist ein Reich aus Beton und Stahl, das Ökosysteme auslaugt. Dieselbe Fülle, die befähigt, gefährdet auch: ökologische Krise, Energiekollaps, steigende Kosten. Wachstum, das Stärke erzeugt, erzeugt auch Zerbrechlichkeit.
Am Ende ist maschinelles Lernen keine Weisheit, sondern Appetit. Keine Reflexion, sondern Akkumulation. Kein Lernen, sondern statistische Wiederholung. Und wie jeder ungezügelte Appetit trägt es seinen eigenen Untergang in sich. Je mehr es verschlingt, desto abhängiger wird es; je mehr es hortet, desto fragiler ist es. Was als strahlende Zukunft verkauft wird, ist in Wahrheit ein vergiftetes Festmahl. Das zweischneidige Schwert des maschinellen Lernens sorgt dafür, dass das algorithmische Reich die Gegenwart dominiert, während es bereits die Bedingungen für seinen Zusammenbruch in sich trägt.
Die Widersprüche der Imperien
Jedes Imperium wird mit der Überzeugung der Ewigkeit geboren. Rom glaubte sich unsterblich; die europäischen Kolonisatoren dachten, ihre Flaggen trügen ein göttliches Schicksal; die Industriemächte schworen, dass Stahl und Dampf eine Zukunft ohne Rückkehr einläuteten. Alle brachen zusammen. Das algorithmische Reich wiederholt dieselbe Illusion: Es präsentiert sich als unausweichlich, als Höhepunkt der Geschichte, als die einzig mögliche Art, das Leben zu organisieren. Doch wie alle Imperien trägt es die Widersprüche in sich, die es zersetzen werden. Seine scheinbare Stärke ist bereits seine Schwäche.
Der erste Widerspruch sind die Kosten. Das Reich speist sich aus unendlichen Daten und verschlingt unvorstellbare Energie. Jedes „intelligente“ Modell erfordert Server, die so viel Strom wie ganze Nationen verbrauchen und durch Flüsse gekühlt werden, die von ihren Läufen abgelenkt werden. Effizienz ist die Maske für Hunger, und Hunger wächst immer. Rom dehnte seine Grenzen zu weit aus; die Kolonisatoren plünderten mehr, als sie regieren konnten; das algorithmische Reich verbraucht mehr, als der Planet ertragen kann. Seine Infrastruktur bereitet bereits seinen Untergang vor.
Der zweite Widerspruch ist die Abhängigkeit. Je mehr Macht es zentralisiert, desto mehr wird es zu Sklaven seiner eigenen Maschinerie. Staaten, die ihre Überwachung auf Algorithmen aufbauen, können ohne sie nicht überleben; Konzerne, die mit Daten Profit machen, können nicht aufhören, sie zu ernten; Armeen, die sich auf Drohnen verlassen, können nicht zu Soldaten aus Fleisch und Blut zurückkehren. Das Reich ist an seine eigene Waffe gekettet. Und Abhängigkeit erzeugt immer Zerbrechlichkeit: Ein Stromausfall, ein logistischer Zusammenbruch, ein Cyberangriff kann auflösen, was unantastbar schien.
Der dritte Widerspruch ist der Mythos. Das Reich vermarktet sich als neutral, unausweichlich, rational. Doch jedes Leck, jede Voreingenommenheit, jede Manipulation reißt diese Maske herunter. Rom wankte, als der Glaube an sein Schicksal schwand; der koloniale Mythos der „Zivilisation“ brach zusammen, als die Brutalität unbestreitbar war. Das digitale Reich steht vor demselben Zerfall: Seine Versprechungen der Neutralität werden täglich durch Enthüllungen über Ausgrenzung und Vorurteile zersetzt. Je stärker der Mythos verkündet wird, desto schwächer wird er, wenn die Realität ihn zerstört.
Der vierte Widerspruch ist der Widerstand. Kein Imperium hat jemals die Fähigkeit des Lebens zu rebellieren ausgelöscht. Quilombos, Streiks, Barrikaden, aufständische Dörfer: Die Geschichte ist übersät mit den Rissen, in denen die Macht versagte. Heute entsteht Widerstand in freier Software, dezentralen Netzwerken, Datenschutzbewegungen, geheimen Hacks. Dies mag fragil erscheinen, aber Zerbrechlichkeit ist auch Widerstandsfähigkeit. Jeder neue Kontrollalgorithmus vervielfacht den Willen zur Flucht. Jeder Versuch, die Herrschaft zu verschärfen, vervielfacht die Risse.
Der fünfte Widerspruch ist die Ausgrenzung. Algorithmen integrieren nicht; sie sortieren, verwerfen, eliminieren. Indem sie Bevölkerungsgruppen ausstoßen, schaffen sie auch Massen, die nichts mehr zu verlieren haben. Kolonisierte Völker erhoben sich im Aufstand; Industriearbeiter kämpften gegen mechanisierte Ausbeutung; die algorithmisch Ausgeschlossenen könnten die neue aufständische Masse werden. Indem es versucht, Ordnung zu schaffen, sät das Reich seine eigene Unordnung. Je mehr es quantifiziert, desto weniger kontrolliert es.
Der sechste Widerspruch ist die kulturelle Erschöpfung. Imperien brauchen Legitimität, Mythen, Geschichten, die ihre Welt zusammenhalten. Das digitale Reich stützt sich auf den Diskurs von Innovation und Fortschritt. Doch der Zynismus wächst: Die Menschen lachen über seine grotesken Misserfolge, zweifeln an seinen großartigen Versprechungen, spüren das Gewicht der algorithmischen Ausgrenzung im täglichen Leben. Das Vertrauen ist brüchig, und wenn der Glaube zusammenbricht, überdauern Imperien nicht.
So steht das algorithmische Reich auf fragilen Fundamenten. Sein Hunger, seine Abhängigkeit, sein Mythos, seine Ausgrenzungen, seine erschöpfte Kultur sind alles Gifte, die es selbst hergestellt hat. Es gibt sich als ewig aus, aber die Ewigkeit ist immer die Lüge des Eroberers. Wie alle vor ihm trägt dieses Reich in sich die Ankündigung seiner eigenen Auflösung.
Kein Imperium bricht im Handumdrehen zusammen. Rom zerfiel nicht an einem einzigen Tag, noch verschwanden die Kolonialreiche mit einem Atemzug. Sie verrotteten von innen, zersetzt durch ihre Widersprüche, bis ein äußerer Schlag oder ein inneres Feuer sie zu Fall brachte. Das algorithmische Reich wird derselben Logik folgen. Es präsentiert sich als ewig, unausweichlich, rational, aber es trägt bereits den Keim des Untergangs in sich. Sein unersättlicher Appetit auf Daten, sein unhaltbarer Energiebedarf, seine Abhängigkeit von Maschinen, die es nicht wirklich kontrollieren kann, seine Unfähigkeit, die Illusion der Neutralität aufrechtzuerhalten, zersetzen seine Grundlagen. Jedes Leck, jeder katastrophale Fehler, jeder Manipulationsskandal ist ein weiterer Riss in dem Glas, das vorgibt, Stahl zu sein.
Doch Ruin ist keine Befreiung. Wenn ein Imperium fällt, erhebt sich ein anderes, um seinen Kadaver zu beanspruchen. Die Gefahr ist nicht der Zusammenbruch selbst, sondern die Substitution: ein Kolonisator ersetzt den anderen, eine Form der Zentralisierung weicht einer noch gefräßigeren. Befreiung erfordert mehr, als auf den Zusammenbruch zu warten; sie verlangt, inmitten des Niedergangs Alternativen zu schaffen. Ohne dies werden Ruinen nur neue Ketten hervorbringen.
Hier liegt die Ironie: Indem es versucht, alles zu kontrollieren, liefert das Reich auch seinen Feinden Waffen. Jede Datenpanne enthüllt die Geheimnisse der Elite; jedes logistische Versagen offenbart die Zerbrechlichkeit; jeder Widerspruch zwischen Versprechen und Realität nährt Misstrauen. Die Gefräßigkeit des Systems wird zu seiner Schwachstelle. Was unsichtbar sein sollte, wird sichtbar gemacht; was unzerstörbar sein sollte, zeigt seine Risse. Die Befreiung beginnt, wenn die Menschen erkennen, dass Macht nicht göttlich, sondern menschlich und daher fehlbar ist.
Aber Maschinen werden uns nicht befreien. Es gibt keine „gute KI“, die uns vor der „schlechten KI“ retten kann. Dieser Mythos ist Teil desselben Reiches. Befreiung kommt nur durch kollektive Weigerung, durch die Ablehnung der Unausweichlichkeit der digitalen Kolonialisierung, durch den Aufbau von Alternativen jenseits der Zentralisierung. So wie Quilombos in der Sklaverei entstanden, so wie aufständische Dörfer sich den Kolonisatoren widersetzten, so wie Streiks die Industrieimperien zum Stillstand brachten, so müssen auch digitale Quilombos geschaffen werden: autonome Netzwerke, Räume der Kooperation außerhalb der Logik der Maschine.
Es wird keine Reinheit, kein technologisches Paradies geben. Widerstand wird prekär, partiell, fragil sein. Aber diese Zerbrechlichkeit ist seine Stärke. Imperien streben nach Totalität, perfekter Effizienz, makelloser Kontrolle. Widerstand gedeiht in Vielfalt, Dezentralisierung, Unberechenbarkeit. Befreiung bedeutet nicht, Technologie zu zerstören, sondern sie zu untergraben: sie den Händen der Herren zu entreißen, sie in ein Werkzeug des Lebens anstatt der Herrschaft zu verwandeln.
Das algorithmische Reich wird fallen, wie jedes Imperium vor ihm. Die einzige Frage ist, ob seine Ruinen als Fundament für die Freiheit dienen oder als Bühne für den nächsten Kolonisator. Freiheit wird niemals gegeben; sie wird ergriffen. Das Reich wird zerbröckeln, aber die Freiheit wird nicht vom Himmel fallen. Sie muss herausgearbeitet, mit bloßen Händen genommen, den Ruinen selbst abgerungen werden.
Klassischer Imperialismus und das algorithmische Reich
Der klassische Imperialismus machte sich nie die Mühe, sich zu verstecken. Er paradierte mit seinen Armeen, hisste seine Flaggen, errichtete seine Stützpunkte auf der ganzen Welt. Seine Grammatik war Territorium, seine Logik die Besatzung. Die Vereinigten Staaten, Russland, China – die heutigen Großmächte – operieren immer noch nach diesem Paradigma, wetteifern um Einflusssphären, Handelsrouten, Energiereserven, strategische Regionen. Die Gewalt ist explizit, auch wenn sie manchmal in das Theater von Verträgen oder „humanitären Interventionen“ gehüllt ist. Der klassische Imperialismus hat nie gezögert, Regierungen zu stürzen, Diktatoren zu bewaffnen oder Stellvertreterkriege zu entfachen. Es ging immer um Besatzung, Kontrolle, Ausbeutung.
Das algorithmische Reich hingegen braucht keine Panzer, die Grenzen überqueren, keine Flaggen, die über eroberten Hauptstädten wehen. Seine Besatzung ist unsichtbar. Sie sickert in Bildschirme, Anwendungen, Datenbanken, soziale Netzwerke. Es kolonisiert nicht Territorium, sondern Subjektivität. Es dominiert nicht nur den physischen Raum, sondern infiltriert den Geist. Wo klassische Imperien Häfen und Straßen bewachten, überwacht das digitale Reich das Bewusstsein, filtert die Wahrnehmung, reguliert den Bedeutungsfluss. Das Schlachtfeld ist nicht länger die Grenze; es ist die Vorstellungskraft. Die Herrschaft findet ohne Soldaten, ohne Paraden statt, aber nicht weniger brutal.
Diese beiden Formen von Imperien sind nicht getrennt, sondern miteinander verflochten. Die Vereinigten Staaten projizieren ihre Macht nicht nur mit Flugzeugträgern, sondern auch mit den globalen Plattformen ihrer Tech-Giganten. Russland setzt nicht nur nukleare Arsenale ein, sondern auch algorithmische Kampagnen, die ausländische Demokratien destabilisieren. China baut nicht nur Häfen und Eisenbahnen, sondern exportiert auch schlüsselfertige Überwachungssysteme an eifrige Autokraten. Das algorithmische Reich ersetzt den klassischen Imperialismus nicht; es erweitert ihn, verfeinert ihn, macht ihn allgegenwärtig. Das eine regiert Körper, das andere regiert Köpfe. Zusammen bilden sie eine doppelte Maschinerie der Herrschaft.
Der Unterschied liegt in der Methode. Der klassische Imperialismus greift die Souveränität an, indem er Staaten stürzt, Eliten korrumpiert und Klientelregime installiert. Das algorithmische Reich umgeht die Souveränität vollständig und wirkt direkt auf die Bevölkerung ein. Eine Nation kann (ausländische) Militärbasen auflösen, aber sie kann ihre Bürger nicht daran hindern, von ausländischen Apps abhängig zu sein. Eine Regierung kann Grenzen kontrollieren, aber sie kann die Kabel unter dem Meer, die ihre Daten transportieren, nicht stoppen. Der klassische Imperialismus spielt immer noch Schach mit Staaten; das digitale Reich spielt mit ganzen Gesellschaften.
Das macht es viel heimtückischer. Klassischer Imperialismus ist sichtbar: Panzer auf den Straßen, Flugzeuge über uns, Soldaten, die Städte besetzen. Der algorithmische Imperialismus ist fast unmerklich. Bürger glauben, dass sie einfach Unterhaltung konsumieren, Nachrichten austauschen, nach Informationen suchen, während in Wirklichkeit ihre Wünsche geformt, ihre Wahrnehmungen gefiltert und ihre Entscheidungen geformt werden. Klassische Imperien verlangten Gehorsam durch Gewalt; das algorithmische Reich kultiviert Gehorsam durch Zustimmung, die als Bequemlichkeit getarnt ist.
Doch seine Subtilität ist auch seine Schwäche. Wo der klassische Imperialismus sichtbaren Aufständen gegenüberstand – Guerillas, aufständischen Staaten, antikolonialen Revolutionen –, steht das algorithmische Reich diffusen, aber wachsenden Sabotageakten gegenüber: Hackern, die Systeme stören, Gemeinschaften, die dezentrale Netzwerke aufbauen, Einzelpersonen, die sich der Transparenz verweigern. Seine Unsichtbarkeit erzeugt unsichtbaren Widerstand. Seine Abhängigkeit von der Infrastruktur – Servern, Stromnetzen, Seekabeln – macht es fragil. Schneiden Sie das Kabel durch, bringen Sie das Netz zum Absturz, und Kontinente werden dunkel. Der Mythos der Allmacht ruht auf sehr fragilen Drähten.
Am Ende sind klassischer Imperialismus und das algorithmische Reich keine Rivalen, sondern Verbündete. Der eine besetzt Land, der andere besetzt das Leben selbst. Der eine setzt Gewalt durch, der andere durch Berechnung. Zusammen bilden sie die Maschinerie des zeitgenössischen Kapitalismus: äußere Repression gepaart mit innerer Kolonialisierung. Beide beanspruchen Ewigkeit; beide sind dem Untergang geweiht. Die Frage ist nicht, ob sie fallen werden, sondern ob ihr Fall den Weg zur Freiheit ebnet oder einfach zu einem neuen Reich, das auf denselben Ruinen wieder aufgebaut wird.