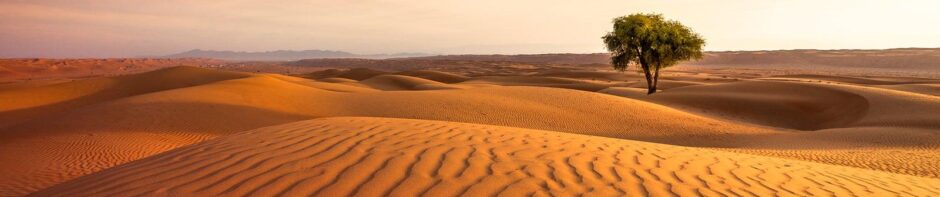Phil A. Neel
Die Preise sind höher. Die Sommer sind heißer. Der Wind ist stärker, die Löhne niedriger und Brände entfachen sich leichter. Tornados ziehen wie Racheengel durch die Städte in der Ebene. Etwas hat sich verändert. Seuchen brennen tief im Blut. Alle zwei Jahre kommt eine große Flut, übersät mit Leichen, um den Boden einer weiteren bestraften Nation zu verwüsten. Hinter uns liegt das große Kohlenstofffeuer der Menschheitsgeschichte. Vor uns liegt ein sich verdunkelnder Schatten, geworfen von unseren eigenen Körpern, gefangen und umherwirbelnd. Jeder spürt, dass etwas ganz und gar nicht stimmt – dass ein Übel in den Boden der Gesellschaft gesickert ist – und jeder weiß, dass die Mächte und Gewalten dieser Welt daran schuld sind. Und doch fühlen wir uns alle machtlos, irgendeine Art von Vergeltung zu üben. Als Einzelne sehen wir keine Möglichkeit, Einfluss auf den Lauf der Dinge zu nehmen, und müssen einfach zusehen, wie sie über uns hinwegrollen. Wir sind entwaffnet und allein, konfrontiert mit einer dunklen Zukunft, in der schauderhafte Schrecken knapp außerhalb unseres Blickfeldes lauern, unaufhaltsam vorwärtsgetrieben, während die Ketten rasseln und die Geräusche der Qualen aus der kommenden Welt widerhallen.
Aber mit den richtigen Augen, die zur richtigen Zeit an die richtigen Stellen schauen, kann man vielleicht den düsteren Schatten der Zukunft sehen, der von Blitzen überirdischen Lichts durchbrochen wird: blendend helle Momente, in denen für einen flüchtigen Augenblick die Perspektive auf Gerechtigkeit erscheint. Das Polizeirevier brennt, die Arbeiter strömen aus der Fabrik, Komitees bilden sich auf den Straßen und in den Dörfern, die Regierung fällt so sanft wie eine Feder, drei Patronenhülsen fallen wie Würfel – in jede ist eine Beschwörungsformel eingraviert, als wolle sie etwas Größeres heraufbeschwören. Vielleicht haben Sie es schon einmal gespürt. Das Herz wird leicht. Engelhaftes Feuer durchströmt das Fleisch, und für diesen einen atemlosen Moment wohnt etwas Unsterbliches in uns. Die Klinge des Meteors schneidet durch den Bauch eines mondlosen Himmels, und dann blinzeln wir, und es ist vorbei: Die Nationalgarde wird gerufen, die Gewerkschaften verhandeln eine Rückkehr zur Arbeit, die Komitees lösen sich auf, der gestürzte Präsident wird durch den Militärrat ersetzt, der tote CEO wird durch einen lebenden ersetzt, und Polizeikugeln fallen wie kalter, harter Regen aus den Glastürmen. Aber das Licht kann nicht ungesehen gemacht werden. Infolgedessen ist gerade diese Niederlage selbst ein Erwachen. Langsam erkennen wir, dass der kollektive, expansive Charakter des Bösen, das uns plagt, eine kollektive, expansive Form der Vergeltung erfordert. Soziale Rache erfordert eine soziale Waffe. Der Name dieser Waffe lautet Kommunistische Partei.
Mit zunehmender Häufigkeit und Intensität von Klassenkonflikten tauchen immer häufiger organisatorische Fragen auf. Diese stellen sich zunächst als unmittelbare, funktionale Fragen, die sich aus konkreten Kämpfen ergeben und mit diesen einhergehen. Im Zuge eines bestimmten Kampfes tauchen dann umfassendere Fragen der Organisation auf, die sowohl eine praktische als auch eine theoretische Dimension annehmen. In praktischer Hinsicht konzentriert sich die Frage weitgehend auf die Aktivität treuer Parteigänger, die ohne ein unmittelbares Objekt ihrer Treue zurückbleiben. Sie drücken eine Restsubjektivität aus, die ihrer Massenkraft beraubt ist. Um es deutlicher zu sagen: Diese Individuen sind „Überbleibsel” einer bestimmten Hochphase des Klassenkonflikts. Auf dieser Ebene wird die Frage in der Regel als Problem gestellt, was dieses fragmentierte „Wir” in der Zeit zwischen den Umbrüchen tun könnte. Infolgedessen ist der Untersuchungsprozess selbst oft von einem frustrierten Eifer geprägt, und die Debatten werden in sich selbst zerfleischenden Kreisen moralischer Schuldzuweisungen geführt, die eher von einem Geist der Selbstbestrafung als von einem ernsthaften Interesse an einer Analyse getrieben sind.
Dennoch verzweigt sich dieselbe Fragestellung bald in ein breiteres Netz von Fragen im Zusammenhang mit „Spontaneität“, dem Verhältnis zwischen strukturellen Trends (in Beschäftigung, Wachstum, Geopolitik usw.) und den wahrscheinlichen Organisationsformen, die von Proletariern jenseits dieser übrig gebliebenen Schicht von Partisanen angenommen werden, und natürlich der Frage, wie diese Partisanen mit solchen Organisationen umgehen könnten. Von hier aus wird die Untersuchung weiterentwickelt und in ihre theoretischen Dimensionen abstrahiert, sodass sie zu einer „Frage der Organisation“ als solcher wird. Obwohl diese Frage der Organisation untrennbar mit umfassenderen Theorien darüber verbunden ist, wie die kapitalistische Gesellschaft funktioniert und wie eine andere Welt aussehen sollte, nimmt sie auch eine liminale Position ein, die gleichzeitig abstrakt (als Theorie der Revolution) und konjunkturell (als notwendiger praktischer Schritt beim Aufbau revolutionärer Macht) ist. Für sich genommen verliert jede dieser Dimensionen schnell an Bedeutung: Der notwendigerweise abstrakte Aspekt wird zu einem mechanischen Determinismus, bei dem in allen Fällen ein einziges Schema angewendet wird (sei es das der „Affinitätsgruppe“ oder das der „Kaderorganisation“); während der notwendigerweise konjunkturelle Aspekt zu einer Form der aktivistischen Untätigkeit wird, bei der gerade die Flut lokaler „Organisationsaktivitäten“ (in der Regel eine Kombination aus themenbezogener Interessenvertretung, Dienstleistungserbringung und Medienarbeit) selbst eine Form der Desorganisation darstellt, die das Partisanen-Projekt lahmlegt.
Die Vereinheitlichung dieser divergierenden Aspekte erfordert Formen der Abstraktion, die aus konjunkturellen Momenten der Revolte hervorgehen und materiell mit ihnen verbunden sind. Jede Diskussion über Organisation muss daher entweder auf einer vollständig lokalisierten Ebene stattfinden – indem diskutiert wird, wie sich diese Menschen in dieser Situation organisieren könnten – oder als generische und synkretistische Zusammenstellung der vielfältigen Organisationsakte, die bereits den Klassenkonflikt prägen, wie ihn die Beteiligten erleben, um ihre Grenzen zu durchdenken und unser Verständnis davon zu verfeinern, was „Organisation” überhaupt genau bedeutet. Hier möchte ich eine Brücke zwischen diesen beiden Funktionen schlagen und eine theoretische Intervention vorstellen, die auf einer relativ hohen Abstraktionsebene operiert – basierend sowohl auf sorgfältigen Studien als auch auf praktischen Erfahrungen innerhalb der Rebellionen, die die Welt in den letzten fünfzehn Jahren erschüttert haben – und die ursprünglich als lokale Intervention konzipiert war, um spezifische Organisationsprojekte, die aus bestimmten sozialen Brüchen hervorgegangen sind, zu schärfen. Mit anderen Worten: Was folgt, ist eine Theorie der Partei, die dazu beitragen soll, konkrete Formen der parteipolitischen Organisation zu katalysieren.
GRUNDPRINZIPIEN
Während wir langsam aus der langen Eklipse der globalen kommunistischen Bewegung heraustreten, befinden wir uns in einer paradoxen Situation, in der wir sowohl zu viel als auch zu wenig geerbt haben. Einerseits verfügen wir über ein reichhaltiges, wenn auch größtenteils textuelles Erbe an Intellekt und Erfahrung, das von früheren Generationen aufgebaut wurde. Und doch ist diese Geschichte inzwischen so weit entfernt, dass sie allzu leicht romantisiert wird, da einst dynamische Programme und Polemiken zu Schemata erstarrt sind und die feurigen Leidenschaften jener Zeit zu einer betäubenden Nostalgie abgekühlt sind. Andererseits hat uns der lange Winter der Unterdrückung in Bezug auf konkrete Erfahrungen und Mentoren nichts als verstreute Überreste hinterlassen. Die Parteien der Vergangenheit wurden alle im Destillierkolben der Repression eingeschmolzen. Die großen Geister wurden gebrochen. Verrat folgte auf Verrat. Die Mutigen wurden zerschlagen und die Feiglinge flohen. Nur die Toten blieben in ihrem Schweigen rein. Unsere Generation wuchs daher in der Wildnis auf, unser Kommunismus war unkultiviert und wild, nur von der rohen Kraft des Kapitals geprägt. Infolgedessen stellen wir nun fest, dass jede Untersuchung der „Frage der Organisation” sofort sowohl durch diese Überfülle an zu weit zurückliegender Geschichte, die allzu leicht zu überladenen Fan-Fiction wird, als auch durch das Fehlen lebendiger Institutionen, die den revolutionären Geist des Partisanenprojekts weiterführen, belastet wird.
Kollektive Subjektivität
Auf den ersten Blick scheint die Frage offensichtlich: Was benötigt wird, ist mehr „Organisation“. Sobald man sich jedoch damit befasst, erweist sich die grundlegende Definition von „Organisation“ als unklar und verschwindet bei dem Versuch, genau zu artikulieren, was damit gemeint ist. Oft dient die Frage selbst nur als Schlagwort. Das Muster ist bekannt: Der „Theoretiker“ blickt auf die jüngsten Kämpfe zurück, diagnostiziert ihre offensichtlichen Grenzen, führt diese auf eine bewusste Entscheidung schlechter oder zumindest naiver Akteure zurück, die sich zu ihrem eigenen Nachteil für „horizontale“ oder „führerlose“ Kampfformen entschieden haben, und verschreibt dann „Organisation“ als Allheilmittel, das in der Vergangenheit hätte gewählt werden müssen und in Zukunft gewählt werden muss. (1) Dabei versäumen es solche „Theoretiker“ zunächst, ein konkretes Bild davon zu vermitteln, wie eine „Organisation“ in der tatsächlichen Situation der Rebellen hätte aussehen können, da es offensichtlich keine revolutionäre Armee gab, die auf die notwendigen Befehle wartete. Noch wichtiger ist, dass sie in ihrer fanatischen Besessenheit von richtigen Ideen auch die grundlegendste Dynamik sozialer Revolten nicht begreifen, in denen aus Massenaktionen eine Form kollektiver Intelligenz entsteht, die über das Denken einzelner Teilnehmer oder sogar programmatischer Gruppierungen politischer Akteure hinausgeht.
Die eigentliche Frage ist jedoch eine ganz andere. Wie jeder, der an einer der großen Rebellionen der letzten fünfzehn Jahre teilgenommen hat, bestätigen kann, mangelt es nie an solchen „Organisationstheoretikern“ oder sogar an kleinen militanten Gruppierungen, die sich aus gleichgesinnten „Kadern“ zusammensetzen und mitten in der Revolte agieren, wobei alle aktiv für ihre eigene Sichtweise der Organisation eintreten, die mit einem kohärenten politischen Programm verbunden ist. Warum scheint sich dann niemand für das zu interessieren, was diese Personen anbieten? Der Grund ist in der Regel ganz einfach: Sie bieten nichts anderes an als das Wort „Organisation“ selbst, dies ad infinitum wiederholend. Obwohl sie selbst vom Gegenteil überzeugt sind, bieten solche Personen und ihre sogenannten „Organisationen“ in der Regel keine konkreten taktischen Erfahrungen oder strategischen Kenntnisse und sind daher nicht in der Lage, die Revolte über ihre Grenzen hinaus voranzutreiben und substanzielle Formen proletarischer Macht aufzubauen. Aus diesem Grund werden sie schnell von der kollektiven Intelligenz der Rebellion selbst ausmanövriert. Selbst in den seltenen Fällen, in denen sie tatsächlich etwas zu bieten haben, gelingt es ihnen nicht, sich so effektiv zu organisieren, dass sie überhaupt jemanden davon überzeugen könnten, sich für das zu interessieren, was sie zu sagen haben. Mit anderen Worten: Sie haben keine Möglichkeit, mit der breiteren Rebellion in Kontakt zu treten oder sich mit ihr auseinanderzusetzen. (2)
Dieser Ansatz zur Frage der Organisation ist selbst ein Symptom für konkrete taktische Grenzen, die sich in der Unfähigkeit von Rebellionen zeigen, bedeutende soziale Veränderungen herbeizuführen oder Formen proletarischer Macht zu schaffen, die nach ihrem Ende Bestand haben können. Er ist aber auch rückständig, da er groß angelegte, programmatische Organisationen, die als Ergebnis jahrzehntelanger revolutionärer Kämpfe in früheren Epochen entstanden sind, als Ausgangspunkt für die Kämpfe von heute nimmt, als ob solche Gebilde durch reine Willenskraft wiederbelebt werden könnten. Der tatsächliche Organisationsprozess ist genau das Gegenteil: Inmitten von Kämpfen und Rebellionen unterschiedlicher Intensität entstehen aus den taktischen Herausforderungen, denen sich die kollektive Intelligenz der Beteiligten stellen muss, unzählige Organisationsformen (die oft fälschlicherweise als „spontan” oder „informell” bezeichnet werden), und erst wenn diese praktische Grundlage der Volksmacht gebildet ist, können „strategischere” oder theoretischere Formen der großräumigen Koordination und Machtbildung Gestalt annehmen. Mit anderen Worten: Diejenigen, die sich der Rebellion anschließen und fordern, dass „wir uns organisieren”, gehen von einem „wir” aus, das noch nicht existiert.
Die Frage der Organisation muss sich zunächst darauf konzentrieren, kollektive Subjektivität aufzubauen, nicht sie zu befehlen. Der Ausgangspunkt der Theorie der Partei ist daher nicht die Frage, wie „wir“ uns organisieren sollten. Stattdessen stellt sich eine doppelte Frage: Wie kann aus den eindeutig nicht-kommunistischen, alltäglichen Kämpfen der Klasse eine spezifisch kommunistische Form revolutionärer Subjektivität hervorgehen? Und wie könnten bestimmte Fraktionen einzelner kommunistischer Partisanen, die aus diesen Kämpfen hervorgegangen sind, wieder in diese Verhältnisse eingreifen, um diese partisanische Subjektivität in und über einzelne Kämpfe hinaus weiterzuentwickeln? Die Entstehung der Partei ist ebenso sehr ein Prozess des Sammelns und Lernens aus der kollektiven Intelligenz der Klasse inmitten von aufrührerischen Konflikten wie eine propositionalen Intervention oder programmatische Synthese. Anstatt auf die jüngsten Aufstände in einem rein negativen Sinne zurückzublicken und ihre Grenzen als Folge falscher Ideen zu verstehen, betrachtet die partisanische Untersuchung diese Misserfolge in erster Linie als materielle Grenzen, die sich taktisch ausdrücken und auch eine treibende, subjektive Kraft in sich tragen. Infolgedessen können sie in einem positiven Sinne als angesammeltes Repositorium kollektiver Experimente gelesen werden, wenn auch nur insofern, als diese Experimente dazu dienen, zukünftige Revolutionszyklen zu beeinflussen.
Die taktische Avantgarde und das Siegel
Die taktischen Grenzen, die sich aufbauen, um jeden sozialen Bruch einzudämmen, können nur durch Handeln überwunden werden, und nur Handeln entwickelt kollektives Denken. Handeln ist die notwendige Schnittstelle zwischen dem isolierten Denken von Individuen oder Gruppen und der massenhaften Subjektivität, die sich in der breiteren Rebellion ausdrückt. Herkömmliche Ansätze zur Frage der Organisation gehen in der Regel davon aus, dass Handeln aus individuellen moralischen oder politischen Überzeugungen resultiert. Diese Ansätze sind insofern „diskursiv“, als sie davon ausgehen, dass politischem Handeln der intellektuelle Vorschlag eines bestimmten Programms vorausgeht. Mit anderen Worten: Es wird angenommen, dass Menschen durch Gespräche, Polemik oder Propaganda davon überzeugt werden, bestimmte politische Ideen zu übernehmen, und dass diese Ideen dann die Übernahme bestimmter strategischer Orientierungen und damit verbundener taktischer Praktiken implizieren. Die Geschichte zeigt jedoch genau das Gegenteil: Politische Positionen entstehen eher aus taktischem Handeln als aus der diskursiven Durchsetzung moralischer oder ideologischer Argumente.
Das Programm an die erste Stelle zu setzen, ist daher rückständig und führt in der Praxis oft zu einer Form der Desorganisation. In Wirklichkeit entsteht Organisation durch die praktische Überwindung materieller Grenzen, wobei ihre intellektuellen, ästhetischen und ethischen Verpflichtungen im Hintergrund bleiben. Mit anderen Worten: Menschen treten nicht en masse Organisationen bei, unterstützen sie oder übernehmen ihre politischen Positionen, Symbole und allgemeinen Einstellungen, weil sie mit ihnen übereinstimmen. Sie tun dies, weil diese Organisationen Kompetenz und Stärke zeigen. In der Militärtheorie wird dieser Prozess als Kampf um die „konkurrierende Kontrolle” über ein offenes Konfliktfeld verstanden. (3) Erst nachdem diese konkrete Führungsstärke in der Praxis etabliert wurde, werden Menschen empfänglich für die abstraktere Führungsstärke in Programmen und Prinzipien. Selbst wenn der propositionale Ansatz also ein theoretisch aufschlussreiches und praktisch nützliches Programm besitzt, wird dieses Programm dennoch keinen Einfluss auf den Lauf der Dinge nehmen können, solange seinen Anhängern die Fähigkeit fehlt, die notwendigen taktischen Interventionen durchzuführen, um mit der kollektiven Intelligenz des Aufstands in Kontakt zu treten.
Darüber hinaus sollten diese Programme selbst als lebendige Ausdrucksformen ihres politischen Moments betrachtet werden. Selbst ihre umfassendste Strukturanalyse drückt eine Form kollektiver Intelligenz aus, die auf eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort beschränkt ist. Infolgedessen sind sie nicht nur provisorisch, sondern müssen auch ergänzt werden und sich aus dem Handeln ergeben. Dieser Prozess formt dann diese Positionen selbst neu und erzeugt neue Formen des politischen Denkens. Die Politik verbreitet und entwickelt sich dadurch über diese taktische Schnittstelle. Durch mutige Taten, die die taktischen Grenzen eines bestimmten Kampfes durchbrechen, kann die Symbolik einer bestimmten Gruppe von Partisanen eine zusätzliche memetische Kraft entwickeln und zu dem werden, was ich als Siegel bezeichne: eine flexible, symbolische Form, die eine bestimmte Dimension der kollektiven Intelligenz der Rebellion in einer vereinfachten visuellen Grammatik komprimiert und verbreitet und dadurch eine expansivere Form der Subjektivität (die historische Partei, die weiter unten untersucht wird) erschließt. (4) In ihrer rudimentärsten Form wirken Siegel auf ästhetischer Ebene: Dinge wie die gelbe Weste oder der gelbe Helm aus den Kämpfen der späten 2010er Jahre. In ihrer ausgefeilteren Form umfassen sie bestimmte taktische Praktiken oder organisatorische Dispositionen, die durch einen Namen und ein Paket minimaler Praktiken vermittelt werden: Betriebsräte, Nachbarschafts-Widerstandskomitees, Besetzungen öffentlicher Plätze usw. Das Siegel setzt Taktiken in weitgehend reproduzierbare Formen um und bietet einen minimalen Zugang, durch den Uneingeweihte (d. h. der Teil der Bevölkerung, der normalerweise als „unpolitisch“ gilt) in den Moment des Bruchs eintreten können. Das Siegel öffnet somit die Aktion für eine breitere soziale Basis von Teilnehmer*innen, unabhängig davon, ob sie sich an diskursive oder programmatische Punkte der Einhalt halten.
Das Siegel entwirft damit eine vorläufige Form kollektiver Subjektivität aus der wogenden Flut der Geschichte. Gleichzeitig ruft es durch seine scheinbar okkulte Kraft eine parteiische Kraft aus der Klasse hervor und strukturiert diese amorphe Subjektivität als praktischer Wegweiser für konkrete Taktiken auch in minimale Organisationsformen. Obwohl memetisch, ist das Siegel nicht in erster Linie ästhetisch und stützt sich für seine Verbreitung nicht auf ein bestimmtes technisches Medium. Siegel entstehen nur durch taktische Beispiele. Politische Dispositionen folgen dann dem Siegel und dienen als chaotische, meist unbewusste Artikulation dieser radikalen Handlungen im Nachhinein. Jemand mit einem gelben Helm zerschlägt die Fenster des Parlaments; das Paket politischer Gefühle und politischer Konflikte, das mit dieser symbolischen Handlung verbunden ist – in diesem Fall der rechte Lokalismus in Hongkong – kann dann durch memetische Replikation weiter verbreitet werden, wodurch die damit verbundenen Symbole und Praktiken den ästhetischen und taktischen Raum der Rebellion leichter hegemonisieren und das Charisma ihrer zugehörigen politischen Positionen weiter verstärken können. (5)
Existentielle Kämpfe
Eine ebenso wichtige Unterscheidung ist die zwischen dem partisanischen Projekt, das nur in und durch größere soziale Brüche aufgebaut werden kann, und den eingeschränkteren Formen des Kampfes, die im ständigen Brodeln des Klassenkonflikts sichtbar werden. (6) Jede kommunistische Organisation muss sich notwendigerweise an den Kämpfen um den Lebensunterhalt orientieren, die aufgrund der widersprüchlichen Dynamik der kapitalistischen Gesellschaft ständig in der gesamten Klasse auftreten. Auch wenn umfassendere politische Ereignisse über diese Kämpfe hinausgehen – und dieser Überschuss ist der eigentliche Ort, an dem eine subjektive Kraft entsteht (siehe unten) –, liegen dennoch anfängliche Konflikte über die Bedingungen und die Durchsetzung des Lebensunterhalts am Ursprung dieser Ereignisse. In ähnlicher Weise strukturieren diese Kämpfe um den Lebensunterhalt das Feld, in dem die Organisation zwischen bestimmten Aufständen bestehen bleiben muss. Jede kommunistische Organisation muss daher in der Lage sein, sich kontinuierlich in konkrete Klasseninteressen umzusetzen, indem sie praktische Funktionen in Bezug auf die spezifischen Bedingungen des Auskommens zu einem bestimmten Zeitpunkt und die spezifischen Methoden, mit denen das Auskommen der Klasse aufgezwungen wird, übernimmt.
Kommunisten müssen sich jedoch auch mit Existenzkämpfen als einer zu überwindenden Grenze auseinandersetzen. Da die Forderungen und Beschwerden, die in solchen Kämpfen zum Ausdruck kommen, aufgezwungene Interessen sind, die letztlich aus Identitäten hervorgehen, die vom Kapital konstruiert wurden (wie beispielsweise in der rassistischen Ablehnung von Arbeitsmigranten zu sehen ist), führt das bloße Verteidigen des materiellen Wohlergehens (d. h. das Kämpfen für reale Zugewinne für die Arbeiterklasse) letztendlich dazu, dass eine kommunistische Organisation ihre Treue zum größeren kommunistischen Projekt verliert. Der zündende Impuls eines jeden Kampfes wird durch tausend kleine Kompromisse ausgeblutet. Tatsächlich ist der „Sieg” in einem jeden Existenzkampf oft selbst eine Niederlage: Der mörderische Polizist wird vor Gericht gestellt (vielleicht sogar für schuldig befunden), die Lohnerhöhung wird durchgesetzt, das umweltschädliche Entwicklungsprojekt wird gestrichen, das umstrittene Gesetz wird zurückgezogen, der Präsident tritt zurück (und die Macht geht an die „Übergangsregierung” über). Der mit Abstand beste Weg, eine kommunistische Bewegung zu besiegen, besteht darin, dass die Partei der Ordnung echte Erfolge in Existenzkämpfen zugesteht und diese Erfolge unter ihrem eigenen Banner konsolidiert.
Allgemein definiert sind Subsistenzkämpfe solche, die sich auf konkrete Fragen des Überlebens unter kapitalistischen Bedingungen konzentrieren. Obwohl diese Kämpfe mehrere Dimensionen haben, lassen sie sich grob in Kämpfe um die Bedingungen der Subsistenz und Kämpfe um die Auferlegung dieser Bedingungen auf die Bevölkerung unterteilen. Erstere konzentrieren sich in der Regel auf relativ eng gefasste Verteilungsfragen des Zugangs zu sozialen Ressourcen, während letztere sich eher auf die umfassenderen Fragen des Überlebens und der Würde konzentrieren, die sich aus der Verteilung dieser Ressourcen ergeben.
Die erste Kategorie, Kämpfe um die Lebenshaltungskosten, dreht sich fast immer in irgendeiner Weise um das Preisniveau. Diese lassen sich weiter unterteilen in Kämpfe um allgemeine Güterpreise (Lebenshaltungskosten, insbesondere Mieten), Kämpfe um den Preis der Arbeitskraft (Löhne, Renten und andere Sozialleistungen) oder Kämpfe um die Preisgestaltung von Dienstleistungen und Ressourcen, die über den Staat bereitgestellt werden (Sozialhilfe, Infrastruktur, Bildung). Institutionelle Unterschiede zwischen den einzelnen Orten sorgen dafür, dass bestimmte Themen (wie das Gesundheitswesen) auf der einen oder anderen Ebene angesiedelt sind oder beide Ebenen betreffen. Plötzliche Preissprünge oder Umverteilungen sozialer Güter können sicherlich groß angelegte Proteste auslösen, und langfristige Inflation und Korruption können die Häufigkeit von Kämpfen um den Lebensunterhalt erhöhen. In der Regel lassen sich diese Kämpfe jedoch leichter in den politischen Bereich integrieren und nehmen nur unter extremen Bedingungen oder wenn parteiische Organisationen existieren, die sie in diese Richtung treiben, eine radikale Wendung. Aus diesem Grund tendiert ihr politischer Ausdruck zu einem einfachen Populismus, der sich auf die Wiederherstellung eines stabilen Preisniveaus konzentriert, das vermutlich durch externe Eingriffe (durch einen Teil der rentenorientierten Eliten) in das ansonsten effiziente Funktionieren des Marktes verzerrt wurde.
Die zweite Kategorie, Kämpfe gegen die Auferlegung dieser Existenzbedingungen für die Bevölkerung, konzentriert sich auf das reine Überleben und die Würde im Leben und bei der Arbeit. Am offensichtlichsten sind die wiederkehrenden, kleineren Proteste gegen Polizeimorde an Armen in einem bestimmten Stadtteil (zumindest diejenigen, die noch keine Massenaufstände sind), Kämpfe gegen Inhaftierungen, rein lokale Proteste gegen Abschiebungen usw. Aber diese Art von Kämpfen überschneidet sich auch mit den anderen. Am Arbeitsplatz beispielsweise sind Kämpfe um die Lebensbedingungen oft weniger durch ihr unmittelbares Ziel (z. B. höhere Löhne) motiviert als durch den Widerstand gegen autoritäre Führungskräfte oder die unterschiedliche Behandlung aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit oder des Migrationsstatus innerhalb des Unternehmens. Solche Konflikte sind oft die brisantesten Themen am Arbeitsplatz, wie jeder weiß, der schon einmal in einem Betrieb organisiert hat. Ähnlich verhält es sich, wenn Kämpfe um die Lebensbedingungen auf Polizeigewalt stoßen: Sie werden sofort zu Kämpfen gegen die Auferlegung dieser Bedingungen für die Bevölkerung. Diese Kämpfe sind daher umfassender als die der ersten Art, nehmen schnell offenere politische Züge an und äußern sich oft als Kämpfe gegen die Herrschaft an sich.
Im Gegensatz zu Kämpfen um die Lebensbedingungen, die sich oft anhand politischer Entwicklungen und Preisniveaus recht genau vorhersagen lassen, sind Kämpfe gegen die Auferlegung dieser Bedingungen für die Bevölkerung äußerst schwer vorherzusagen. Abgesehen von der allgemeinen Erkenntnis, dass solche Kämpfe am ehesten in bestimmten Gebieten und unter Bevölkerungsgruppen ausbrechen, die extremer Erniedrigung ausgesetzt sind, und dass sie sich am effektivsten ausbreiten, wenn ein bestimmter Fall weit verbreitet bekannt wird, ist es beispielsweise schwierig zu sagen, wann ein bestimmter Polizeimord zu Protesten führen wird, und praktisch unmöglich zu sagen, wann er eine weit verbreitete Revolte auslösen könnte, die dann über ihre ursprünglichen Grenzen hinausgeht. In der Regel sind diese Kämpfe jedoch schwieriger über bestehende Institutionen zu kontrollieren und verbreiten sich leichter, da ihre Unterdrückung weitere Revolten auslöst.
Bestimmte Konstellationen von Existenzkämpfen bilden den Nährboden für Massenaufstände, die dann über diese ursprünglichen Grenzen hinauswachsen und nicht mehr nur Ausdruck dieser zugrunde liegenden Existenzkonflikte sind. Obwohl beide Arten von Existenzkämpfen hier eine Rolle spielen, ist es in der Regel die zweite Art, die als unmittelbarer Auslöser fungiert. Die anhaltenden Proteste in Indonesien sind ein gutes Beispiel dafür: Die seit langem schwelenden Kämpfe um die Lebensbedingungen (Lebenshaltungskosten, staatliche Verteilung von Ressourcen, Zugang zu Beschäftigung usw.) bildeten die Grundlage für eine Reihe von Beschwerden, die zunächst nur zu begrenzten Protesten führten. Diese eskalierten dann zu einem massiven Jugendaufstand, nachdem die Polizei einen Lieferfahrer brutal ermordet und weitere Proteste gewaltsam unterdrückt hatte, was zu weiteren Todesfällen führte. Dennoch finden auch aggressive Kämpfe gegen die Auferlegung von Lebensbedingungen innerhalb derselben Grenzen statt wie alle anderen Kämpfe um Lebensbedingungen und bringen konkrete Interessen zum Ausdruck, die dann von der Partei der Ordnung kooptiert werden können. (7)
Ökumenisch und experimentell
Jeder Anspruch einer Partei, den einzig wahren Weg zur Revolution zu kennen, ist offensichtlich lächerlich. Revolutionen sind weder in der Theorie noch in der Praxis monokulturell. Das Einzige, was Kommunisten vereinen sollte, ist daher eine strikte Ablehnung von Sektierertum und jeglichem Anspruch auf Gewissheit. Unsere Praxis muss von Anfang an ökumenisch und experimentell sein, Unterschiede kultivieren, zusammenführen und katalysieren, die dann in einen ständigen Dialog miteinander gebracht werden. Nur wenn wir heterogene Ansätze in unsere Bemühungen einbeziehen, können wir erwarten, neue Lösungen für die unzähligen intellektuellen und taktischen Grenzen zu finden, mit denen jeder revolutionäre Prozess konfrontiert ist. Dies erfordert eine Haltung der Offenheit gegenüber apolitischen oder antipolitischen Strömungen sowie gegenüber denen, deren stilistischer oder tonaler Ausdruck von Politik sich von unserem eigenen unterscheidet, anstatt solche ästhetischen Unterschiede klobig in angeblich politische Kritik umzuwandeln.
Gleichzeitig ist Ökumene nicht gleichbedeutend mit Eklektizismus. Und Experimentalismus ist nicht dasselbe wie die Romantisierung von Neuem. Es geht nicht darum, einfach „das Nützliche” aus einer beliebigen Quelle zu „entlehnen”, um ein fröhliches Patchwork radikaler Ideen zu schaffen, oder sich auf eine „neue” Taktik oder Haltung im Kampf zu versteifen (die in Wirklichkeit fast immer eine alte ist), sondern vielmehr darum, fragmentarische Wahrheiten herauszuarbeiten und zu einer vielfältigen, aber dennoch kohärenten kommunistischen Idee zu integrieren, die von allen Partisanen geteilt wird, wobei jeder das gleiche Grundprojekt in unzähligen Dimensionen ausarbeitet. Der Kommunismus hält gerade durch die Vielfalt der Ausdrucksformen, aus denen er besteht, zusammen. Diese Vielfalt setzt jedoch voraus, dass diese Ausdrucksformen dennoch um eine bestimmte Reihe von Mindestbedingungen zirkulieren, ähnlich wie ein Pendel um einen bestimmten (aber auch virtuellen oder emergenten) Schwerpunkt schwingt. So weit wie möglich vereinfacht lassen sich diese Bedingungen wie folgt zusammenfassen: die Überzeugung, dass das Ziel eines solchen Projekts die Schaffung einer planetarischen Gesellschaft ist, die nach den Prinzipien der Deliberation, der Nicht-Dominanz und der freien Assoziation funktioniert und die enormen (wissenschaftlichen, produktiven, spirituellen, kulturellen usw.) Fähigkeiten der menschlichen Spezies nutzt, um ihren Stoffwechsel mit der nicht-menschlichen Welt wiederherzustellen.
Diese Mindestbedingungen entfalten sich dann zu einer Reihe weiterer Fragen und Schlussfolgerungen, die durch das Partisanen-Projekt selbst ausgearbeitet werden müssen. Per Definition muss jede Gesellschaft, die nach diesen Prinzipien funktioniert, die indirekte oder verdeckte Herrschaft, die in Werten als soziale Form (einschließlich Geld, Märkte, Löhne usw.) und in den daraus folgenden Formen legaler und illegaler Identität (d. h. der Status als „Bürger“ eines „Landes“ mit unterschiedlichen Rechten) verankert ist, sowie direkte Formen der Herrschaft, die sich im Staat, in der obligatorischen Einbindung in autoritäre Familieneinheiten, in patriarchalen oder fremdenfeindlichen Bräuchen usw. ausdrücken, abschaffen. Ebenso muss der Kommunismus, da er einen Phasenübergang zwischen fundamental unterschiedlichen Formen der sozialen Organisation mit sich bringt, aus einem revolutionären Bruch mit der alten Welt hervorgehen und kann nicht langsam durch evolutionäre Mittel der allmählichen Reform und Entwicklung der Produktivkräfte erreicht werden. Daraus ergibt sich vielleicht die wichtigste Trennlinie: jene, die Kommunisten von all jenen trennt, die das zügellose Verhalten der Menge im Moment des Aufstands fürchten, abtun oder als infantil betrachten und stattdessen entweder geordnete und „friedliche“ Protesttaktiken oder eine mythische Form militanter Disziplin bevorzugen, als wären Aufstände chirurgische Militäroperationen und nicht chaotische Massenerhebungen.
Oberflächlich betrachtet scheint dies ein Paradoxon zu sein: Wenn wir Einigkeit als Synonym für Gleichheit und damit als das genaue Gegenteil von Vielfalt oder Unterschiedlichkeit betrachten, würden diese Bedingungen einen ausschließenden Charakter annehmen, der dem Geist der Ökumene widerspricht. Was hier jedoch vorgeschlagen wird, ist keine strenge oder übergeordnete Einheit, die untergeordnete Elemente außer Kraft setzt und vereinheitlicht, sondern lediglich ein erforderliches Maß an Kohärenz. Diese Mindestbedingungen müssen zwar durchgesetzt werden, um ein ökumenisches Umfeld zu gewährleisten, das die Verbreitung wahrhaft kommunistischer Ideen ermöglicht, doch ist dieser Prozess der Einschränkung gleichzeitig auch generativ. Ohne eine solche Durchsetzung würden nicht-kommunistische „radikale” oder „linke” Ideen, die näher am gesunden Menschenverstand der populären Ideologie liegen, kommunistische Inhalte schnell verwischen. Obwohl es wichtig sein wird, mit diesen vagen „sozialistischen”, „abolitionistischen” oder „aktivistischen” Strömungen im Gespräch zu bleiben – da ihre eigenen Widersprüche dazu neigen, eine Minderheit intelligenterer Teilnehmer zum Kommunismus zu führen –, ist es noch wichtiger, sich von ihnen abzugrenzen und sich zu weigern, das kommunistische Projekt in diesem lauwarmen radikalen Liberalismus aufzulösen. Dies ermöglicht es uns dann, die Grundlage für unsere eigenen Experimente zu schaffen, sodass kommunistische Partisanen verschiedene Formen der Intervention und des Engagements ausprobieren und die Ergebnisse anschließend klar und nüchtern zusammenstellen können.
THEORIE DER PARTEI
Wenn wir von kommunistischer Organisation sprechen, meinen wir nicht Organisation im Allgemeinen. Obwohl verschiedene Organisationstheorien – aus der Kybernetik, Biologie oder sogar aus Beispielen für Koordinationsstrukturen in Unternehmen oder beim Militär – natürlich aufschlussreich sind, fehlt ihnen doch ein notwendigerweise transzendentes Merkmal: die parteiische Ausrichtung auf eine Idee. Partisanentum erfordert nicht nur eine Theorie der Organisation, sondern speziell der Partei. Darüber hinaus ist es für Kommunisten eine Frage, die nur durch eine in der Praxis ausgearbeitete „Theorie” der Partei formuliert werden kann: eine Theorie, die kontinuierlich aus den praktischen Lehren aus der langen Geschichte der Klassenkämpfe aufgebaut und immer wieder in diesen Konflikt zurückgeführt wird, um getestet und weiter verfeinert zu werden. Auch wenn diese Theorie zu einem bestimmten Zeitpunkt von bestimmten Denkern zusammengestellt und artikuliert werden mag, drückt sie letztlich ein kollektives Erbe aus, das durch das Handeln der Klasse kontinuierlich neu gelernt und neu erfunden wird.
Die historische Partei (invariant)
Auf einer hohen Abstraktionsebene können wir die Theorie der Partei in drei unterschiedliche, aber miteinander verbundene Konzepte unterteilen. Das erste davon, die historische Partei, ist auch das umfangreichste und umfasst die Summe der scheinbar spontanen Formen massenhafter Unruhen, die immer wieder aus Kämpfen um die Lebensbedingungen hervorgehen. Es wird im Singular gesprochen: Es gibt eine einzige historische Partei, die unter der kapitalistischen Gesellschaft in allen Regionen und Epochen brodelt, obwohl sie nur in ihrem Aufschwung sichtbar wird. Marx bezeichnet sie auch als „Partei der Anarchie”, da sie von der „Partei der Ordnung”, die sie zu unterdrücken versucht, und von der „Anti-Partei”, die sie vollständig ausschließen will, als solche behandelt wird. (8) Diese Partei ist in den schwelenden Kämpfen um den Lebensunterhalt immer zumindest vage erkennbar. Allerdings drücken Existenzkämpfe an sich keinen kommunistischen Inhalt aus und nehmen nicht „natürlich“ einen partisanen Charakter an. Ganz im Gegenteil: Existenzkämpfe neigen dazu, die bestimmten Interessen sozial geprägter Identitäten zum Ausdruck zu bringen, und daher ist es am wahrscheinlichsten, dass sie relativ begrenzte, repräsentative Forderungen entwickeln, die, selbst wenn sie über „soziale Basisbewegungen“ zum Ausdruck gebracht werden, vollständig im Bereich der konventionellen Politik operieren: Reformforderungen an die bestehenden Mächte, Appelle an die öffentliche Meinung und sogar die Durchsetzung der isolierten Interessen eines Teils der Klasse gegenüber anderen.
Existenzkämpfe allein lassen sich am besten als Ausdrucksformen politischen Bewusstseins verstehen, in denen „Subjektivität“ auf die bloße Repräsentation der sozialen Stellung reduziert wird. Im Gegensatz dazu entsteht der emanzipatorische Horizont, der in der Bewegung der historischen Partei sichtbar wird, nur über die Repräsentation hinaus, obwohl er notwendigerweise auch aus einer bestimmten sozialen Verortung hervorgeht (d. h. aus den spezifischen Konflikten und Machtverhältnissen, die diesem Ort eigen sind). Revolutionäre Subjektivität ist die Ausarbeitung einer praktischen Universalität, die in Spannung zu ihren eigenen Entstehungsbedingungen steht. (9) So wird die Existenz der historischen Partei am deutlichsten, wenn die Kämpfe ums Überleben eine bestimmte Intensität erreichen, an der sie einen selbstreflexiven Charakter annehmen, der über die Grenzen ihrer ursprünglichen Beschwerden hinausgeht. In herkömmlicher Terminologie ist dies der Punkt, an dem einzelne Kämpfe zu vielfältigen „Massenaufständen” werden. Diese exzessiven sozialen Brüche können dann auch zu politischen Singularitäten werden, oder zu dem, was der politische Philosoph Alain Badiou als „Ereignisse” bezeichnet, die das Gefüge dessen, was an einem bestimmten Ort möglich erscheint, verzerren und dadurch die Koordinaten der politischen Landschaft neu ordnen. (10)
Für sich genommen ist die historische Partei eine nicht-ganz-subjektive-Kraft. Obwohl sie sicherlich Formen des „Klassenbewusstseins“ hervorbringt, agiert die historische Partei selbst auf einer Ebene, die am besten als Unterbewusstsein der Klasse beschrieben werden kann. Daher wirkt sie oft unausgereift, undurchschaubar und reaktiv. Darüber hinaus ist die Intensität einer bestimmten Reaktion oft äußerst schwer vorherzusagen. Beispielsweise kommt es ständig zu Tötungen durch die Polizei, aber nur bestimmte Fälle – die im Wesentlichen mit allen anderen identisch sind – führen zu Massenaufständen. Nichtsdestotrotz hängt die Bewegung der historischen Partei offensichtlich auch mit langfristigen strukturellen Trends an einem bestimmten Ort und in der kapitalistischen Gesellschaft als Ganzes zusammen. Tatsächlich können wir uns sogar vorstellen, dass sie durch die inhärente Spannung zwischen sozial existierenden Identitäten (dem anti-emanzipatorischen „politischen Bewusstsein“ von Existenzkämpfen und sozialen Bewegungen) und ihrer übermäßigen Überbetonung in dem Ereignis vorangetrieben wird.
Dies erklärt die Höhen und Tiefen der historischen Partei, die durch das Zusammentreffen dieser objektiven Trends und ihre subjektive Ausarbeitung im Klassenkampf bestimmt werden, sowie ihre Unveränderlichkeit. Die grundlegenden Gesetze der kapitalistischen Gesellschaft ändern sich nicht, und Krise und Klassenkampf sind die Mittel, durch die sich diese Gesellschaft reproduziert. Aus diesem Grund wird es immer zu Existenzkämpfen kommen, die, wenn sie mit einer bestimmten Häufigkeit und Intensität auftreten, immer dazu neigen, über ihre eigenen Grenzen hinauszuschwappen und politische Ereignisse hervorzurufen, in denen die historische Partei sichtbar wird. Durch ihren Konflikt mit der bestehenden Welt projiziert die historische Partei dann ein Bild des Kommunismus ins Negativ.
Dieses Bild ist in zweierlei Hinsicht unveränderlich. Erstens bleiben die Mindestvoraussetzungen für die Zerstörung der kapitalistischen Gesellschaft unverändert, da sich die grundlegende soziale Logik dieser Gesellschaft nicht ändert. Wir können dies als „theoretische“ oder „strukturelle“ Unveränderlichkeit betrachten. Zweitens ist auch der Prozess, durch den revolutionäre Subjektivität Gestalt annimmt, unveränderlich, da Kommunisten immer mit denselben zentralen Problemen konfrontiert werden und auf ähnliche Reaktionen der Kräfte der sozialen Ordnung stoßen, was zu einem strategischen Feld führt, das in grundlegender Weise mit dem identisch ist, mit dem revolutionäre Kräfte in der Vergangenheit konfrontiert waren. Wir können dies als „praktische“ oder „subjektive“ Unveränderlichkeit betrachten.
Die Enteignung, die der Existenz des Proletariats zugrunde liegt und sich in den alltäglichen Existenzkämpfen zeigt, sowie die Möglichkeit der proletarischen Macht, die sich in den politischen Exzessen des Ereignisses manifestiert, verbinden sich zu einem potenziellen, virtuellen oder spektralen Bild des Kommunismus, das aufgrund einer Kombination aus Umständen und Temperament für bestimmte Beteiligte sichtbar ist, für andere jedoch nicht. Indem sie die Grenzen eines bestimmten Kampfes aufzeigen, entwickeln diese Beteiligten ein größeres Muster, Prinzip oder eine Wahrheit: die unveränderliche Idee des Kommunismus. Aus dem gleichen Grund öffnen Ereignisse direkt eine bestimmte Dimension des Absoluten und verbinden Aufstände aus sehr unterschiedlichen Zeiten und Orten zu derselben Ewigkeit, die selbst eine Reflexion der potenziellen kommunistischen Zukunft in der Gegenwart ist.
Die formelle Partei (vergänglich)
Formelle Parteien stellen Versuche dar, dieses Muster innerhalb und außerhalb von Ereignissen auszuarbeiten und diese unveränderliche Idee in die vergängliche Materie selbstbewusster Versammlungen von Individuen einzuprägen. Von formellen Parteien wird im Plural gesprochen: Es gibt immer mehrere formelle Parteien, die gleichzeitig agieren, wobei jede nach ihrer eigenen Methode der Koppelnavigation ihren Weg sucht und so das Muster oder Prinzip in unterschiedliche Richtungen ausarbeitet, die häufig gegeneinander wirken.
Keine einzelne formelle Partei kann jemals als „“Vorhut“ der Klasse als Ganzes bezeichnet werden. Dennoch wird die historische Partei, genau wie die sich auftürmenden Wellen eine tiefere fließende Bewegung darunter repräsentieren, immer ihre eigenen Avangarde hervorbringen. Jede formelle Partei hat daher das Potenzial, als eine von vielen Avantgarden der historischen Partei zu fungieren. Diese Avantgarden agieren oft in unterschiedlichen Dimensionen: Einige formelle Parteien bringen ein fortgeschritteneres und umfassenderes theoretisches Verständnis zum Ausdruck, während andere über verfeinertes taktisches Wissen verfügen oder einfach ihren Geist im Kampf hell erstrahlen lassen, wobei jede mutige Tat ein neues Signalfeuer entzündet, um die Klasse in ihren schicksalhaften Kampf zu führen.
Diese Parteien entstehen in der Regel aus dem selbstreflexiven Übermaß des Ereignisses, können jedoch auch in intervallischen Perioden in schwacher Form auftreten, insbesondere wenn das allgemeine Niveau der parteipolitischen Subjektivität hoch ist. Im Grunde entsteht eine formelle Partei immer dann, wenn sich Gruppen von Individuen zusammenschließen, um ein Ereignis bewusst zu erweitern, zu intensivieren und weiter zu universalisieren. Formelle Parteien überdauern oft auch den Aufschwung der historischen Partei und versuchen in der Intervallperiode zwischen sozialen Umbrüchen, die durch das Ereignis enthüllte kollektive Wahrheit auszuarbeiten, sich auf zukünftige Aufstände vorzubereiten oder (sofern sie dazu in der Lage sind) wieder in die vorherrschenden Verhältnisse einzugreifen, um das Entstehen zukünftiger Ereignisse wahrscheinlicher zu machen und sicherzustellen, dass sie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, frühere Grenzen zu überwinden. In diesem Sinne drücken formelle Parteien eine schwache oder partielle Form der Subjektivität aus, oder genauer gesagt, den anfänglichen, stockenden Prozess, durch den ein revolutionäres Subjekt entsteht.
Die überwiegende Mehrheit der formellen Parteien sind kleine und praxisorientierte Gruppierungen, die einen „taktischen” oder praktischen Charakter haben und in der Regel aus provisorischen funktionalen Kollektiven hervorgehen, die sich inmitten eines Kampfes gebildet haben: ein Organisationskomitee in einer Streikwelle, die Gemeinschaftsküche bei einer Besetzung, Gruppen von Frontkämpfern, die sich in gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei engagieren, Studien- und Forschungskollektive, die gebildet werden, um den Kampf besser zu verstehen, oder verschiedene Nachbarschaftsräte, die unweigerlich inmitten einer Revolte entstehen. Formelle Parteien können aber auch größer, explizit politischer und sogar „strategisch“ ausgerichtet sein, solange sie diesen partisanen Aspekt beibehalten. Taktische Gruppen, die sich nicht auflösen, tendieren in diese Richtung. Infolgedessen können sie sich sogar zu nominellen „kommunistischen Parteien” entwickeln, die sich jeweils als kommunistische Partei eines bestimmten Ortes bezeichnen und oft im Gegensatz zu anderen, sich überlappenden „kommunistischen Parteien” stehen. Keine von ihnen ist jedoch die kommunistische Partei als solche.
Auch wenn es wie ein Rätsel klingt, existieren formelle Parteien, unabhängig davon, ob sie sich selbst als solche bekennen oder nicht. Das heißt, formelle Parteien beschreiben auch „informelle“ Gruppierungen, die sich selbst möglicherweise nicht als kohärente „Organisationen“ betrachten. Beispiele hierfür sind Gruppen von Freunden, die sich jeden Abend inmitten der Unruhen treffen, Subkulturen, die sich an den Aufständen beteiligen und anschließend durch deren Folgen gespalten werden, und natürlich die verschiedenen „Affinitätsgruppen“ und „informellen Organisationen“, die ironischerweise oft über strengere Disziplin und ausgefeiltere Kommandostrukturen verfügen. Ungeachtet ihrer vermeintlichen „Informalität“ funktionieren diese Gruppen in Wirklichkeit nach den Formalitäten von Gewohnheit, Charisma und einfacher funktionaler Trägheit.
Der Unterschied zwischen „informellen“ und „formellen“ Gruppen besteht nicht darin, ob es sich um formelle Parteien handelt (beide sind es), sondern darin, inwieweit diese Formalität ein explizites und selbsterklärtes Merkmal der Organisation ist. Ebenso hat ihr partisaner Aspekt – das Bekenntnis zur Erarbeitung der kollektiven Wahrheit des Ereignisses im Allgemeinen und zur Überwindung der Grenzen eines bestimmten Ereignisses – nichts mit ihren programmatischen Aussagen zu tun. Formelle Parteien werden stattdessen auf die Probe gestellt und verlieren oder behalten ihren Status als parteipolitische Organisationen, wenn sie mit neuen politischen Ereignissen konfrontiert werden. Solche Ereignisse zeigen, ob diese Partei dem kommunistischen Projekt treu geblieben ist, indem sie Bedingungen schafft, unter denen ihre Haltung und ihr Verhalten angesichts der „Anarchie“, die durch einen bestimmten Aufstand ausgelöst wird, auf die Probe gestellt werden können. Engagiert sie sich überhaupt für die neue Revolte? Wenn ja, neigt ihre Form des Engagements dazu, diese Revolte auf konservativere Wege zu lenken? Oder erfüllt sie eine praktische Funktion, indem sie dazu beiträgt, diese Revolte über ihre Grenzen hinaus voranzutreiben?
Wenn dies nicht gegeben ist, verliert die ehemalige formelle Partei an Bedeutung: Sie ist dann keine Partei mehr, sondern lediglich eine Organisation oder, schlimmer noch, ein operatives Organ der Partei der Ordnung oder eine Anti-Partei. Dies ist einer der Gründe, warum die formelle Partei immer nur von kurzer Dauer ist. Als funktionale und oft zufällige Gruppierungen lösen sich formelle Parteien oft selbst auf, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, oder sie verändern ihre Form und entwickeln sich von eng verbundenen taktischen Gruppierungen inmitten eines Aufstands zu einer eher amorphen sozialen Szene in dessen Folge. Größere Organisationen behalten hingegen oft nur den Anschein einer formellen Partei bei, um dann an der Bewährungsprobe des Ereignisses selbst völlig zu scheitern. An diesem Punkt ziehen sie sich in die Bedeutungslosigkeit zurück, werden von den Strömungen der Geschichte hinweggespült oder verhärten sich zu nichts anderem als einer sektenähnlichen Gruppe, die keine praktische Funktion erfüllt. Nach derselben Logik können bereits bestehende Organisationen plötzlich partisanische Funktionen übernehmen und dadurch zu formellen Parteien werden, unabhängig davon, ob sie vor dem Aufstand explizit politisch waren (Abolitionisten, Gewerkschaften, Hilfsvereine) oder nur am Rande politisch (Fußball-Ultras, Kirchen, Katastrophenhilfeorganisationen).
Das „Abwerfen“ verknöcherter formeller Parteien ist jedoch an sich produktiv, da zukünftige formelle Parteien dann durch ihre Opposition gegen diese verknöcherten Organe entstehen und dabei fortgeschrittenere Formen der Subjektivität zum Ausdruck bringen. Aus diesem Grund bilden frisch aufgelöste und verknöcherte formelle Parteien so etwas wie die Bodenstruktur, aus der komplexere Formen des politischen Lebens hervorgehen können. Um diese Komplexität zu verstehen, muss man genauer zwischen verschiedenen Organisationsformen als solchen unterscheiden (insbesondere zwischen den apolitischen und vorpolitischen Organisationen, die am ehesten partisane Züge annehmen oder für Partisanen am nützlichsten sind) und zwischen verschiedenen Arten formeller Parteien: die rein taktische und zufällige, die „informelle” militante Gruppe, die „formelle” militante Gruppe, die radikale Gewerkschaft, die Selbstverteidigungsmiliz, die vorgebliche „Volksarmee”, die nominelle „kommunistische Partei” usw.
Die atomare Form der partisanen Organisation bezeichne ich als „kommunistisches Konklave“. Kommunisten entstehen inmitten politischer Ereignisse und treten oft allein oder bestenfalls in sehr kleinen Gruppen in Erscheinung. Ebenso finden Kommunisten oft inmitten von Kämpfen zueinander und beginnen, sich auf informelle Weise zu koordinieren. Diese kleinen Gruppen von Kommunisten können aufgrund ihres privaten und etwas ritualisierten Charakters und natürlich aufgrund der Tatsache, dass sie in Treue zu einem transzendenten Projekt organisiert sind, als „Konklaven“ bezeichnet werden. Überall, wo sich zwei oder drei als Kommunisten versammeln, existiert ein Konklave, unabhängig davon, ob es sich selbst als solches versteht. Konklaven funktionieren in erster Linie über Affinität. Einige entwickeln diese Affinität dann zu einer formelleren Arbeitsteilung oder zu größeren, informellen Subkulturen weiter. Oft dienen Konklaven als Keimzelle für komplexere formelle Parteien.
Selbst wenn formelle Partisanenprojekte entstehen, bestehen jedoch weiterhin Konklaven innerhalb und zwischen ihnen. Diese informellen Verbindungen sind selbst wichtige formelle Parteien. Sie dienen dazu, die Kluft zwischen partisanen und nicht-partisanen Organisationen zu überbrücken, formelle Partisanenprojekte enger zu integrieren und Widerstandsfähigkeit und Redundanz zu bieten, wenn formelle Organisationen unter Druck geraten und zerfallen. Mit anderen Worten: Innerhalb komplexerer formeller Parteien wird es immer kleinere formelle Parteien geben. Informalität und Formalität, Spontaneität und Vermittlung, Undurchsichtigkeit und Transparenz stehen nicht im Widerspruch zueinander. Keine von beiden kann gegenüber der anderen bevorzugt oder vollständig beseitigt werden. Geheimniskrämerische Konklaven werden (müssen und sollten) innerhalb formeller kommunistischer Organisationen mit transparenter Mitgliedschaft existieren, und noch geheimniskrämerischere Konklaven werden innerhalb der Konklave existieren.
Theorie, taktische Erfindungen und Kameradschaft werden in diesen dunklen, intimen Räumen geschmiedet, bevor sie an offeneren Orten durch transparente Diskussionen, Debatten und Experimente weiterentwickelt werden. Auch wenn ein Konklave von außen sichtbar sein mag, bleibt es doch eine relativ undurchsichtige Institution. Einerseits stellt dies immer eine Gefahr für die größere Organisation dar, da es Hinterzimmerintrigen und heimliche Machtübernahmen ermöglicht. Andererseits ist es gerade diese Privatsphäre, die es dem Konklave ermöglicht, experimentell und kreativ zu sein. Komplexere formelle Parteien müssen so gestaltet sein, dass sie gleichzeitig gegen die Persistenz relativ undurchsichtiger formeller Parteien in ihrem Inneren schützen und diese berücksichtigen und im Idealfall diese Organe als Quelle der Vitalität nutzen. Obwohl diese Konklaven potenziell in offene Fraktionen oder Gruppierungen innerhalb größerer Organisationen integriert werden können, sind sie nicht gleichbedeutend mit diesen und werden oft eher durch Zufallsfaktoren (wie gemeinsame Erfahrungen in einem Kampf) als durch theoretische Übereinstimmung zusammengehalten. Sie gehen daher dieser öffentlicheren Fraktionsarbeit voraus, und eine einzelne Fraktion umfasst wahrscheinlich mehrere Konklaven.
Die kommunistische Partei (ewig)
Die kommunistische Partei entsteht durch das Zusammenspiel der historischen Partei und der vielen formellen Parteien, die sie hervorbringt, wobei sie beide umfasst und übersteigt. Schließlich führt eine Kombination struktureller Faktoren zu erhöhten Turbulenzen innerhalb der historischen Partei. Unterdessen ist die schwache oder teilweise subjektive Kraft verschiedener formeller Parteien, die durch Willen oder Umstände miteinander verbunden sind, schließlich in der Lage, wieder in die umgebenden Bedingungen einzugreifen, um die historische Partei, die sie hervorgebracht hat, weiter zu beleben. Das Ergebnis ist eine neu entstehende Organisationsform, die in einem völlig anderen Maßstab operiert als die zufälligen Aufschwünge der historischen Partei oder die provisorischen, taktischen und weitgehend lokalisierten (wenn auch groß angelegten) Aktivitäten der formellen Parteien. Die kommunistische Partei ist einzigartig, aber vielfältig.
Als expansives Umfeld zunehmend organisierter Parteinahme ist die kommunistische Partei niemals der Name für eine bestimmte, offizielle „Kommunistische Partei“, die irgendwo auf der Welt tätig ist. Obwohl diese vielen „großgeschriebenen“ kommunistischen Parteien oft wichtige Elemente der „kleingeschriebenen“ kommunistischen Partei sind, kann sie nicht auf sie reduziert werden. Darüber hinaus ist es immer ein großer strategischer Fehler, zu versuchen, die Kommunistische Partei als solche den Interessen einer einzelnen Kommunistischen Partei unterzuordnen (selbst wenn diese Kommunistische Partei mittlerweile für einen lokalen revolutionären Aufschwung steht). Die Kommunistische Partei lässt sich vielleicht am besten als eine Art „Meta-Organisation“ verstehen, die sowohl die Weiterentwicklung formeller Parteien ermöglicht als auch die Vitalität der darunter liegenden historischen Partei weiter stimuliert. Man kann daher von der kommunistischen Partei als einer Art partisanen „Ökosystem“ sprechen, insofern als das Zusammenspiel der historischen Partei und der vielen in ihr verwurzelten formellen Parteien buchstäblich ein parteiisches Territorium schafft, das dann als Medium für die nachfolgende Organisation seine eigenen auftauchenden Zwänge und Anreize mit sich bringt.
Dieses Bild der Partei als „Ökosystem“ ist jedoch in Wirklichkeit ideologisch geprägt. Schließlich wird die Metapher des Ökosystems in der liberalen politischen Philosophie wegen ihrer angeblich „horizontalen“ Logik bevorzugt, die die (ebenfalls angeblich „horizontalen“) Abläufe des Marktes zu replizieren scheint. Und in diesem Fall erfasst sie einfach nicht das gesamte Bild: Die kommunistische Partei ist kein Ökosystem des Kampfes, das sich blindlings in der Geschichte ausbreitet. Sie ist vielmehr der Punkt, an dem die schwache Subjektivität, die in der formalen Partei sichtbar ist, in eine starke Subjektivität übergeht, die der Aufgabe der Revolution angemessen ist. Diese revolutionäre Subjektivität erstreckt sich notwendigerweise über einzelne Organisationen und ist selbst organisiert, intentional, relativ sich selbst bewusst (obwohl dies von der Position des Einzelnen innerhalb der Partei abhängt) und in ihrer Geografie und Demografie ungleich verteilt.
Die kommunistische Partei wurde traditionell auch in der allzu lockeren Sprache einer „internationalen kommunistischen Bewegung“ und in der allzu engen Sprache jeder gegebenen „Internationale“ beschrieben, der dann ein gewisser ordinaler Status in der historischen Abfolge zugewiesen wird. Letztendlich lässt sie sich am besten irgendwo zwischen der Amorphie eines Ökosystems oder einer Bewegung und der starren kapitelartigen Struktur der verschiedenen Iterationen der formalen, föderativen Internationalen verorten. Aber sie ist auch expansiver als beides, insofern ihre realen organisatorischen Kapazitäten außerhalb der breiten „kommunistischen Bewegung“ oder der engen Föderationen der „kommunistischen Parteien“ liegen. Sie werden stattdessen an ihrer Beziehung zu den spezifischen räteartigen oder beratenden Vereinigungen gemessen, die aus der Klasse inmitten eines Aufstands hervorgehen und die dann, ob dazu aufgefordert oder nicht, beginnen, kommunistische Maßnahmen zu ergreifen, wodurch sie die Kommunen bilden, die (wenn sie überleben) zum Kernland und Motor der revolutionären Abfolge werden. Kommunen können jedoch nur entstehen, wenn der Kreislauf zwischen formalen Parteien und der historischen Partei gut etabliert ist und ein subjektives Umfeld schafft, in dem beratende, enteignende und transformative Formen der freien Vereinigung zu einem organischen Auswuchs der Klassenaktivität werden.
Wie das Ereignis kann auch die kommunistische Partei entstehen, in Vergessenheit geraten und später wieder auftauchen – aber es handelt sich immer um dieselbe kommunistische Partei, die durch einen roten Faden mit ihren früheren Inkarnationen verbunden ist. Ihr umfangreiches (geografisches, demografisches) und intensives (organisatorisches, theoretisches, spirituelles) Wachstum ist selbst die Welle der Revolution, die den Prozess des kommunistischen Aufbaus in Gang setzt. Ähnlich wie die formelle Partei kann auch die kommunistische Partei zu verknöchern scheinen, verfallen und ihre Treue zum kommunistischen Projekt aufgeben, wie damals, als die sozialdemokratischen Parteien der Zweiten Internationale sich zu reformistischer Staatskunst und Kriegführung entwickelten. In einer solchen Situation verknöchert die kommunistische Partei jedoch nicht wirklich, sondern wird stattdessen verdrängt. Eine solche Verdrängung kann durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, wird jedoch immer durch das Versagen der formellen Parteien signalisiert, die einst die kommunistische Partei bildeten, ihre Treue zum kommunistischen Projekt aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund wird das explosive Wiederaufleben der kommunistischen Partei oft gegen diese erstarrten Überreste ausgearbeitet, wie beispielsweise als die Dritte Internationale aus einer Reihe von Meutereien, Aufständen und Revolutionen hervorging, die ursprünglich versuchten, den Parteiaufbau der Zweiten Internationale nachzuahmen, und schließlich gezwungen waren, sich in Opposition zu eben diesem Erbe zu entwickeln.
Die kommunistische Partei befindet sich seit langem in einer Phase des Niedergangs, und obwohl es Anzeichen für ein Wiederaufleben gibt, kann man noch nicht sagen, dass sie in nennenswerter Form existiert. Noch einmal: Die Partei als solche ist nicht nur die Summe der „linken” Aktivitäten zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern eine Form der Supra-Subjektivität, die nur in der explosiven Konfrontation mit der vorherrschenden sozialen Welt besteht und als Passage dient, durch die der Kommunismus als praktische Realität ausgearbeitet werden kann. Die kommunistische Partei ist also nicht die sinnlose Ansammlung vieler kleiner Interessen in einem komplexen System, sondern sie repräsentiert die materialisierte Entfaltung der menschlichen Vernunft, die notwendig ist, damit die Spezies ihre eigene soziale Struktur sich ihrer selbst bewusst verwalten kann, die gleichzeitig ihr sozialer Stoffwechsel mit der nicht-menschlichen Welt ist. (11) Deshalb können wir von der kommunistischen Partei als dem sozialen Gehirn des Partisanen-Projekts und sogar als der Entstehungsstätte der kommunistischen Gesellschaft selbst sprechen.
Die kommunistische Partei ist daher ewig, in dem Sinne, dass sie die Larvenform eines unsterblichen Körpers ist: die Blüte von Vernunft und Leidenschaft in einer sich selbst bewussten Spezies, die ihre eigene Aktivität als geosphärisches System bewusst koordiniert. (12) Mit anderen Worten, die kommunistische Partei ist die einzige Waffe, die fähig ist, die Klassengesellschaft wirklich zu zerstören – den ewigen Kampf zwischen einfachem Egalitarismus und sozialer Vorherrschaft aufzuheben, indem sie beide einem höheren Prinzip des Wohlstands unterordnet – und ist durch eben diese Zerstörung auch das Vehikel, durch das die von der historischen Partei enthüllte und von der Vielzahl der formalen Parteien ausgearbeitete Wahrheit in einer völlig neue Ära der materiellen Existenz erblüht, die einen rationalen sozialen Stoffwechsel auf planetarer Ebene untermauert.
Anmerkungen
1. Eine ähnliche Kritik dieses Ansatzes, angewendet auf ein konkretes Beispiel, findet sich bei: Jasper Bernes, „What Was to Be Done? Protest and Revolution in the 2010s“, The Brooklyn Rail, Juni 2024. Online hier.
2. Vielleicht noch aussagekräftiger ist die Frage, warum diese Personen und die ihnen nahestehenden Organisationen, obwohl sie nach der Revolte durch Wahlen scheinbar „an die Macht gekommen“ sind (wie im Fall von Syriza, Podemos oder der Regierung Boric in Chile), es dann völlig versäumt haben, bedeutende soziale Veränderungen herbeizuführen. Tatsächlich hat die Umleitung der Volksaufstände in Wahlkampagnen fast überall als unterdrückende Kraft gewirkt und dazu beigetragen, die wenigen Formen proletarischer Macht, die sich außerhalb des institutionellen Bereichs herausgebildet hatten, zu zersetzen. Dies geschieht unabhängig von politischen Vorlieben oder den Absichten einzelner Führer.
3. Für einen Überblick über diese Idee siehe: David Kilcullen, Out of the Mountains: The Coming Age of the Urban Guerrilla, Oxford: Oxford University Press, 2015, S. 124–127
4. Das Konzept des „Siegels” ist eine Weiterentwicklung des „Memes with Force”, das von Paul Torino und Adrian Wohlleben in ihrem Artikel „Memes with Force: Lessons from the Yellow Vests” (Mute Magazine, 26. Februar 2019; online hier) entwickelt und in Adrian Wohlleben, „Memes without End”, Ill Will, 17. Mai 2021 fortgeführt wurde (online hier).
5. Die Verwendung eines Beispiels aus dem rechten Spektrum ist hier kein Zufall, da rechte Organisationen sich in den letzten Jahrzehnten als besonders geschickt darin erwiesen haben, diese Logik anzuwenden. Ein Grund für den Aufstieg der Rechten ist gerade, dass diese Art der Führung von den „Linken“ oft rundweg abgelehnt wird, die sie als eine inhärent autoritäre Auferlegung auf die spontane Dynamik der Klasse betrachten und nicht als eine selbstreflexive Dynamik, die durch eben diese Dynamik entsteht. Dadurch geht der flüchtige Moment verloren, und die Siegel verbrennen von selbst. Ich untersuche die Auswirkungen dieses Problems auf die Politik in den USA in ‘Hinterland: America’s New Landscape of Class and Conflict’ (Reaktion, 2018) und beleuchte dasselbe Dilemma in Hongkong in den Kapiteln 6 und 7 von ‘Hellworld: The Human Species and the Planetary Factory’ (Brill, 2025).
6. Das Partisanen-Projekt bezieht sich auf fortlaufende Versuche, eine Form kollektiver revolutionärer Subjektivität zu organisieren, die auf kommunistische Ziele ausgerichtet ist. Mit anderen Worten, es bezieht sich sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die Zukunft des Kampfes, die Menschheit von den historischen Fesseln der Klassengesellschaft zu befreien und eine kommunistische Zukunft einzuleiten. Es ist daher in etwa gleichbedeutend mit „kommunistischer Organisation” oder „kommunistischer Bewegung”.
7. Selbst innerhalb massiver politischer Aufstände, die über die Grenzen des in Form konkreter Interessen zum Ausdruck gebrachten Unterhalts hinausgehen, besteht dennoch eine Spannung zwischen diesem Übermaß und seinen Ausdrucksgründen. Durch die Ausnutzung dieser Spannung zugunsten des Ausdrucks werden diese politischen Brüche unterdrückt und wieder in den Status quo integriert.
8. Marx spricht von der „Partei der Anarchie“ und der „Partei der Ordnung“ in einer Reihe von Artikeln, die er 1850 für die Neue Rheinische Zeitung schrieb und die später von Engels 1895 in dem Buch ‘Klassenkämpfe in Frankreich: 1848-1850’ zusammengefasst wurden. In dieser Buchversion erscheinen die Begriffe in Kapitel 3. Dieselben Begriffe tauchen auch in späteren Werken wieder auf, beispielsweise 1852 in ‘Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte.’ Der Begriff „Anti-Partei” ist meine eigene Ergänzung, die ich in ‘Hinterland’ (Auszüge hier verfügbar) eingeführt habe.
9. Dieser theoretische Rahmen stammt aus dem Werk des politischen Philosophen Michael Neocosmos. Siehe sein Werk „Thinking Freedom in Africa: Toward a Theory of Emancipatory Politics“, Wits University Press, 2016.
10. Die gleichzeitig universelle und aleatorische Natur des Ereignisses bedeutet jedoch auch, dass diese Neuordnung der Koordinaten nach wie vor schwer zu beschreiben ist. So ist beispielsweise für praktisch jeden Beobachter klar, dass sich nach den Unruhen im Zusammenhang mit George Floyd „alles verändert hat“, und doch fällt es uns allen schwer, genau zu erklären, wie sich die Dinge verändert haben, oder einen einzelnen Fall zu nennen.
11.Für eine weitere Ausarbeitung dieser Idee siehe: Phil A. Neel und Nick Chavez, „Forest and Factory: The Science and Fiction of Communism“, Endnotes, 2023. Online hier.
12. Genauer gesagt: die Selbstverwirklichung der „Spezies“ als Subjekt, jenseits ihres Status als offensichtliche biologische Tatsache, die in Wirklichkeit die materielle Einheit der menschlichen Produktionstätigkeit in der kapitalistischen Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Dies ist die praktische Verwirklichung dessen, was der sowjetische Geologe Wladimir Wernadskij (der den Begriff „Biosphäre“ populär machte) einst spekulativ als „Noosphäre“ bezeichnet hat. Die Idee wird ausführlicher in Neel, Hellworld, Kapitel 2, behandelt.
Dieser Text wurde am 6. September 2025 auf Ill Will Editions veröffentlicht und von Bonustracks ins Deutsche übersetzt.